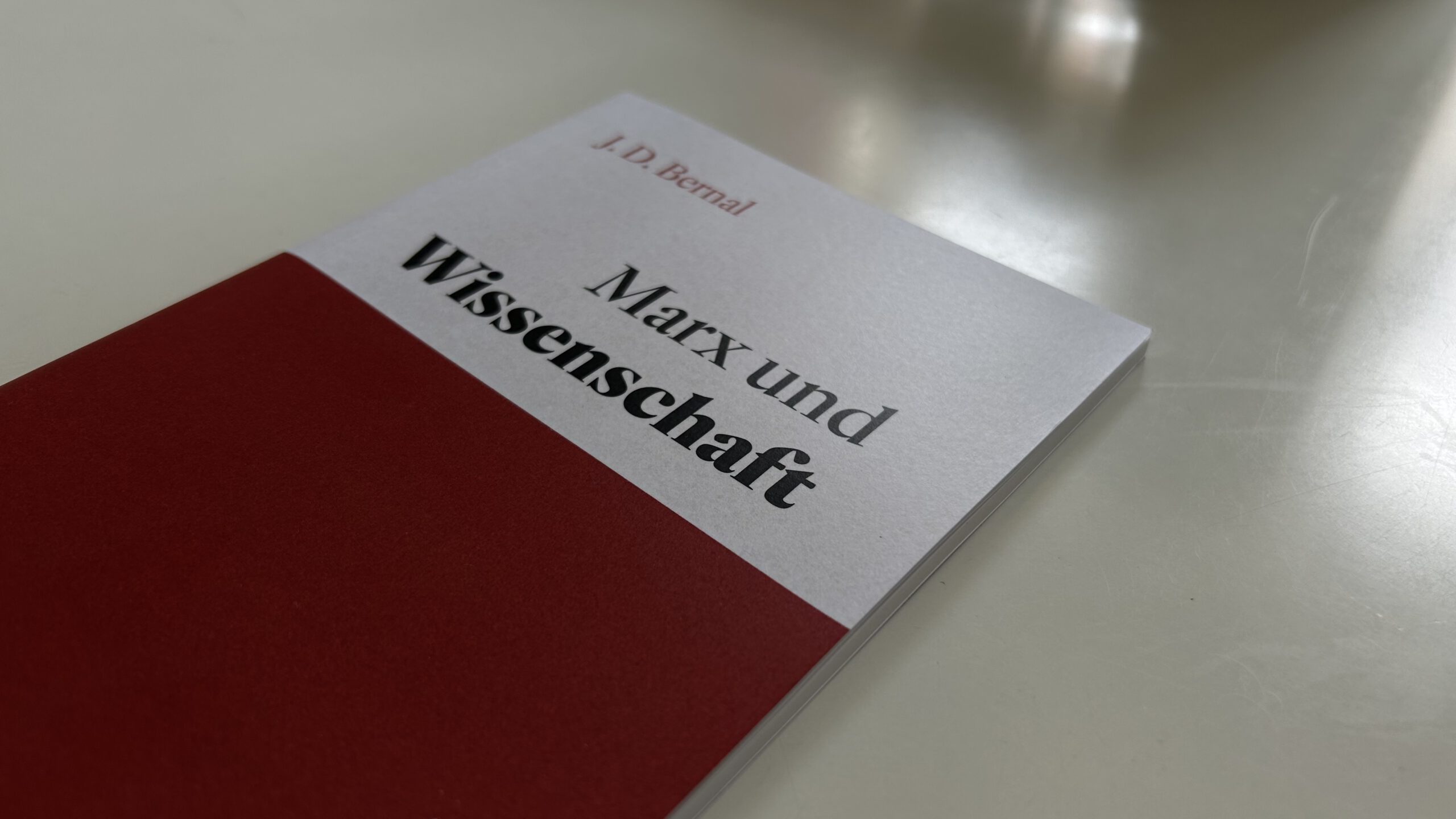Der folgende Text ist als Broschüre erhältlich unter info@arbeit-zukunft.de Übersetzt nach J.D. Bernal: Marx and Sience. New York 1952.
Einleitung
Vor einigen Wochen besuchte ich mit einem bedeutenden Dichter von der Westküste Afrikas das Grab von Marx auf dem Highgate-Friedhof. Als wir dort allein vor dem schlichten Denkmal standen, dachte ich darüber nach, wie der Mann, der dort begraben liegt, heute in allen Teilen der Welt bekannt ist und verehrt wird. Ich dachte daran, wie er jeden Aspekt und jedes Feld des menschlichen Denkens beeinflusst hat, die Naturwissenschaften ebenso wie die wirtschaftlichen und politischen Zweige, die sein besonderes Anliegen waren.
Es scheint fast schon überflüssig, von Marx‘ Beitrag zur Wissenschaft zu sprechen, denn Marx war selbst ein Wissenschaftler. Ausgehend von der Beobachtung und Ausübung der schwierigsten aller Wissenschaften – der Wissenschaft von der menschlichen Gesellschaft in ihrer historischen Entwicklung – erfasste er die gesamte Bandbreite der Wissenschaften. Dennoch hätte er Journalist, Historiker oder Ökonom bleiben können, wenn er sich auf die Analyse und Betrachtung dieser menschlichen Wissensgebiete beschränkt hätte. Durch die Verbindung von Theorie und Praxis war er jedoch in der Lage, das ganze Gewicht seiner hohen Intelligenz einzusetzen. So nahm er die die gesamte Methode des Denkens und Handelns, die wir als Sozial- und Naturwissenschaften bezeichnen, auf und veränderte sie.
Was Marx für die Wissenschaft in seiner Zeit getan hat und was das Ergebnis seiner Arbeit in Zukunft für die Wissenschaft bedeuten wird, ist das Thema dieses Vortrags. Sein großer Beitrag war, dass er zum ersten Mal den grundlegenden gesellschaftlichen Charakter der Wissenschaft und die damit einhergehende Notwendigkeit der Wissenschaft für die Gesellschaft herausgestellt hat. Dazu bedurfte es der Erfassung des gesamten Spektrums der Wissenschaft sowie einer tiefen Kenntnis der Geschichte und der Philosophie.
Es fällt uns heute schwer zu begreifen, was für eine große Leistung das war, denn die Grundlagen der marxistischen Ideen sind heute selbst für die erbittertsten Anti-Marxisten selbstverständlich. Die große Entdeckung von Marx war, dass die eigentliche Triebkraft der Geschichte, der menschlichen sozialen Entwicklung, nicht in abstrakten Ideen oder mystischer Eingebung zu finden war. Sie lag in dem Prozess selbst, durch den die Menschen ihr Überleben sicherten – dem produktiven Prozess, durch den sie Nahrung, Kleidung und Unterkunft erhielten. Die Produktion, die von vornherein eine gesellschaftliche war, brachte gesellschaftliche Produktionsverhältnisse mit sich, die zum Entstehen gegensätzlicher Klassen führten. Ihre Kämpfe, die den wesentlichen Teil der Geschichte ausmachen, lassen sich in ungebrochener Folge bis in die Gegenwart und darüber hinaus verfolgen und sind die Quelle der geistigen Produktion der menschlichen Kultur. Diese Ideen, deren Beweis und Vertiefung Marx einen Großteil seines Lebens widmete, wurden von ihm schon früh in seinem Lebenswerk fest erfasst. So finden wir in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten (1844):
„Dies materielle, unmittelbar sinnliche Privateigentum ist der materielle sinnliche Ausdruck des entfremdeten[1] menschlichen Lebens. Seine Bewegung – die Produktion und Konsumtion – ist die sinnliche Offenbarung von der Bewegung aller bisherigen Produktion, d.h. Verwirklichung oder Wirklichkeit des Menschen. Religion, Familie, Staat, Recht, Moral, Wissenschaft, Kunst etc. sind nur besondre Weisen der Produktion und fallen unter ihr allgemeines Gesetz.“[i]
Ein Jahr später sollte er schreiben:
„Die Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen Generationen, von denen Jede die ihr von allen vorhergegangenen übermachten Materiale, Kapitalien, Produktionskräfte exploitiert, daher also einerseits unter ganz veränderten Umständen die überkommene Tätigkeit fortsetzt und andrerseits mit einer ganz veränderten Tätigkeit die alten Umstände modifiziert…
„…so daß z.B., wenn in England eine Maschine erfunden wird, die in Indien und China zahllose Arbeiter außer Brot setzt und die ganze Existenzform dieser Reiche umwälzt, diese Erfindung zu einem weltgeschichtlichen Faktum wird…“[ii]
Wir verdanken Marx diese Einsicht in die sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen der Geschichte, die in der einen oder anderen Form in das gesamte moderne Denken eingedrungen ist, selbst in das der gläubigsten Obskurantisten oder der schärfsten Anti-Marxisten. Ihre heutige Bekanntheit sollte uns nicht vergessen lassen, dass es eine enorme intellektuelle Leistung von Marx war, diese Erkenntnis entgegen dem gesamten Denken seiner Zeit zu erlangen.
Die Marxschen Ideen sind von der Gültigkeit seiner eigenen Theorie nicht ausgenommen. Es war keineswegs ein Zufall, dass es einem Mann mit seinem Hintergrund und seiner Erfahrung zufiel, diese Entdeckung zu machen. Obwohl sie in der Entwicklung des Denkens und der Politik des frühen 19. Jahrhunderts latent vorhanden war, besteht ein großer Unterschied zwischen der vagen Annahme der gegenseitigen Abhängigkeit verschiedener Bestandteile der Kultur und der präzisen Form dieser Beziehung, die Marx mit Hilfe der von ihm entwickelten neuen dialektischen Methode dargelegt hat.
Diese Methode kann nicht verstanden werden, ohne sich mit den ursprünglichen Schriften von Marx zu befassen. Deshalb bin ich persönlich besonders froh, diese Vorlesung gehalten zu haben, denn sie hat mich dazu veranlasst, viele wohlbekannte Klassiker des Marxismus zu studieren, aber auch einige seiner früheren und weniger bekannten Schriften, die ich jetzt zum ersten Mal gelesen habe. Es ist seltsam, wie die Erfahrung der Nachkriegszeit das, was vor mehr als hundert Jahren geschrieben wurde, heute viel klarer erscheinen lässt als beim ersten Lesen. Je mehr sich die Beispiele für die wirtschaftlichen und politischen Ereignisse der letzten Jahre häufen, desto deutlicher wird, worauf Marx hinauswollte. Es erscheint mehr denn je erstaunlich, dass er ohne die Bandbreite der wirtschaftlichen und politischen Ereignisse, die uns seine Ideen in diesem Jahrhundert wieder vor Augen geführt haben, zu dem Verständnis gelangen konnte, das er hatte.
Obwohl Marx bereits 1843, im Alter von fünfundzwanzig Jahren, zu seinen wichtigsten Schlussfolgerungen gelangte, waren sie keineswegs das Ergebnis einer brillanten Eingebung, sondern eines intensiven Studiums und einer genauen Beobachtung des Lebens und der Gesellschaft. Der eigentliche Prozess, durch den Marx, wenn man so sagen darf, zum Marxisten wurde, ist eines der interessantesten Beispiele für die Entwicklung des menschlichen Denkens. Er verdient eine sehr ausführliche und detaillierte Untersuchung, und alles, was ich jetzt darüber sage, muss als sehr laienhafte Bemühung betrachtet werden; aber sie lohnt sich, weil diese Art von kritischen Umwälzungen des Denkens die wirklich revolutionären Ereignisse sind, die, viel mehr als die ständige Anhäufung von Fakten, die Eroberung der menschlichen Intelligenz über seine Umgebung markieren.
Wie Marx zum Marxist wurde. Philosophie und Religion
Karl Marx wurde 1818 als Sohn eines wohlhabenden Trierer Juristen geboren und erhielt die Erziehung eines typischen liberalen Intellektuellen der damaligen Zeit. Ausgebildet für das Recht, konnte er sein Interesse nicht darauf beschränken, sondern streifte schon in seiner Schulzeit durch viele kulturelle Bereiche. Obwohl er ein Theaterstück und einige satirische Gedichte verfasste, fand er sein erstes ernsthaftes und fesselndes Interesse an der Philosophie. Als er 1837 nach Berlin kam, wurde er fast zwangsläufig zum Hegelianer, denn Hegel vertrat zu dieser Zeit die vollständigste Synthese, wie abstrakt und idealistisch auch immer, der Revolution im Denken, die in Deutschland den Platz der politischen und industriellen Revolutionen in Frankreich und England eingenommen hatte.
Der große Beitrag von Hegels Denken zu dem von Marx war seine Betonung der Entwicklung von Prozessen und nicht der Existenz von Dingen. Doch Hegels strikter Idealismus verhinderte, dass sein „Prozess“ irgendeine konkrete Realität hatte. Die Idee einer Evolution in der Natur war einfach nicht denkbar; die natürliche Welt erschien auf einmal, wie in den einfachsten Schöpfungsmythen. Aber Hegel behauptete eine Evolution, eine Entwicklung in aufeinanderfolgenden Stufen, in der menschlichen Geschichte.[2] Er prägte den Satz: „Alles, was vernünftig ist, ist wirklich.“ Dies bedeutete jedoch nicht Beständigkeit, sondern Veränderung. Wie Engels erklärt:
„Nun ist aber die Wirklichkeit nach Hegel keineswegs ein Attribut, das einer gegebnen gesellschaftlichen oder politischen Sachlage unter allen Umständen und zu allen Zeiten zukommt. Im Gegenteil. Die römische Republik war wirklich, aber das sie verdrängende römische Kaiserreich auch. Die französische Monarchie war 1789 so unwirklich geworden, d.h. so aller Notwendigkeit beraubt, so unvernünftig, daß sie vernichtet werden mußte durch die große Revolution, von der Hegel stets mit der höchsten Begeisterung spricht. Hier war also die Monarchie das Unwirkliche, die Revolution das Wirkliche. Und so wird im Lauf der Entwicklung alles früher Wirkliche unwirklich, verliert seine Notwendigkeit, sein Existenzrecht, seine Vernünftigkeit; an die Stelle des absterbenden Wirklichen tritt eine neue, lebensfähige Wirklichkeit – friedlich, wenn das Alte verständig genug ist, ohne Sträuben mit Tode abzugehn, gewaltsam, wenn es sich gegen diese Notwendigkeit sperrt. Und so dreht sich der Hegelsche Satz durch die Hegelsche Dialektik selbst um in sein Gegenteil: Alles, was im Bereich der Menschengeschichte wirklich ist, wird mit der Zeit unvernünftig, ist also schon seiner Bestimmung nach unvernünftig, ist von vornherein mit Unvernünftigkeit behaftet; und alles, was in den Köpfen der Menschen vernünftig ist, ist bestimmt, wirklich zu werden, mag es auch noch so sehr der bestehenden scheinbaren Wirklichkeit widersprechen. Der Satz von der Vernünftigkeit alles Wirklichen löst sich nach allen Regeln der Hegelschen Denkmethode auf in den andern: Alles was besteht, ist wert, daß es zugrunde geht.
Darin aber grade lag die wahre Bedeutung und der revolutionäre Charakter der Hegelschen Philosphie…“[iii]
Dies war die Lehre der Hegelschen dialektischen Philosophie, die direkt auf Marx überging. Wiederum Engels folgend:
„Wie die Bourgeoisie durch die große Industrie, die Konkurrenz und den Weltmarkt alle stabilen, altehrwürdigen Institutionen praktisch auflöst, so löst diese dialektische Philosophie alle Vorstellungen von endgültiger absoluter Wahrheit und ihr entsprechenden absoluten Menschheitszuständen auf. Vor ihr besteht nichts Endgültiges, Absolutes, Heiliges; sie weist von allem und an allem die Vergänglichkeit auf, und nichts besteht vor ihr als der ununterbrochne Prozeß des Werdens und Vergehens, des Aufsteigens ohne Ende vom Niedern zum Höhern, dessen bloße Widerspiegelung im denkenden Hirn sie selbst ist. Sie hat allerdings auch eine konservative Seite: Sie erkennt die Berechtigung bestimmter Erkenntnis- und Gesellschaftsstufen für deren Zeit und Umstände an; aber auch nur so weit. Der Konservatismus dieser Anschauungsweise ist relativ, ihr revolutionärer Charakter ist absolut – das einzig Absolute, das sie gelten läßt.“[iv]
Hegel selbst hat diese Konsequenz sicherlich nicht gesehen, er war zu sehr damit beschäftigt, ein universelles System auszuarbeiten, in dem das Absolute, das sich ihm zuerst offenbart hatte, im preußischen Staat von Friedrich Wilhelm III. verkörpert war. Aber um noch einmal Engels zu zitieren:
„Die Gesamtlehre Hegels ließ, wie wir gesehn, reichlichen Raum für die Unterbringung der verschiedensten praktischen Parteianschauungen; und praktisch waren im damaligen theoretischen Deutschland vor allem zwei Dinge: die Religion und die Politik. Wer das Hauptgewicht auf das System Hegels legte, konnte auf beiden Gebieten ziemlich konservativ sein; wer in der dialektischen Methode die Hauptsache sah, konnte religiös wie politisch zur äußersten Opposition gehören.“[v]
Marx gehörte von Anfang an zu der zweiten Gruppe, den Linkshegelianern, aber sein Bruch mit der idealistischen Philosophie kam nicht sofort. Seine erste Originalarbeit, seine Dissertation von 1841, zeigte, dass Hegels eigene Methode ihn von den idealistischen Schlussfolgerungen seines Meisters wegführte. Ihr Titel lautete „Der Unterschied zwischen der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie“. Diese Philosophen waren die Begründer des materialistischen Atomismus, im Gegensatz zum nicht-atomaren Materialismus der frühen Ionier oder zum idealistischen Atomismus des Pythagoras,[3] und mit ihrer Erörterung, wenn auch noch in hegelianischen Begriffen, begann Marx seine Erkundung der gesellschaftlichen und politischen Implikationen des Materialismus. Marx zog Epikur Demokrit vor, weil Demokrit ihm als rein naturalistisch-materialistischer Philosoph erschien, der alles auf Atome und das Nichts reduzierte, während Epikur diese Atomphilosophie, mit gewissen Variationen, zur Grundlage einer moralischen und politischen Theorie machen wollte. Mit seinen eigenen Worten schließt Marx:
„Bei Epikur ist daher die Atomistik mit allen ihren Widersprüchen als die Naturwissenschaft des Selbstbewußtseins, das sich unter der Form der abstrakten Einzelheit absolutes Prinzip ist, bis zur höchsten Konsequenz, welches ihre Auflösung und bewußter Gegensatz gegen das Allgemeine ist, durchgeführt und vollendet. Dem Demokrit dagegen ist das Atom nur der allgemein objektive Ausdruck der empirischen Naturforschung überhaupt. Das Atom bleibt ihm daher reine und abstrakte Kategorie, eine Hypothese, die das Resultat der Erfahrung, nicht ihr energisches Prinzip ist, die daher ebensowohl ohne Realisierung bleibt, wie die reale Naturforschung nicht weiter von ihr bestimmt wird.“[vi]
Obwohl Marx‘ Thesen in einer Sprache formuliert sind, die dem heutigen Leser fast unverständlich erscheinen muss, enthalten sie doch viele eindringliche Beobachtungen. Dazu gehört die Anerkennung des begrenzten, unbefriedigenden Charakters der reinen Naturwissenschaft und die Bedeutung des epikurischen Gesetzes der atomaren Abweichung, mit dem der Zufall in den starren Atomismus des Demokrit eingeführt wird. Der Zweck der These war jedoch keineswegs akademisch. Es ging darum, die befreiende Rolle der epikureischen Ideen darzulegen, insbesondere im Kampf gegen die staatlich geförderte Religion. Neuere Forschungen haben gezeigt, inwieweit der Epikureismus im antiken Griechenland und Rom als subversive Philosophie galt und wie er durch die Bemühungen der offiziellen platonischen und stoischen Philosophien weitgehend zerstört wurde.
Wäre Marx ein konventioneller Philosoph gewesen, so hätte er diesen vielversprechenden Anfang fortsetzen und als höchst angesehener Geheimrat Professor an einer deutschen Universität werden können. Aber er konnte sich nicht von den Ereignissen der Zeit fernhalten. Kaum war seine Dissertation fertig – er hat sie nie gedruckt -, engagierte er sich mit anderen linken Hegelianern im Journalismus, zunächst als Mitarbeiter und dann, 1842, als Herausgeber der Rheinischen Zeitung, einer neuen liberalen Zeitung. Das Bindeglied zwischen Philosophie und Politik bildete für ihn die Religionskritik, die ihrerseits eine politische Frage war, da die Religion die Stütze, der den preußischen Staat beherrschenden Grundbesitzinteressen war. Wie Marx es selbst formulierte:
„Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik.“[vii]
Der stärkste intellektuelle Einfluss, der zu dieser Zeit auf ihn wirkte, war der von Feuerbach, selbst ein sehr ruhiger und zurückhaltender Philosoph, der aber den Mut hatte, der selbst Hegel fehlte, sich in seinem „Das Wesen des Christentums“ (veröffentlicht 1841) direkt gegen das gesamte christliche Dogma zu stellen. Marx und sein Kreis studierten Feuerbach, ließen sich von ihm inspirieren und waren sofort bereit, weit über ihn hinauszugehen. Marx fasste dies in einem seiner frühesten und schärfsten Aufsätze, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ der 1843 veröffentlicht wurde, zusammen:
„Für Deutschland ist die Kritik der Religion im wesentlichen beendigt, und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik.“
„Das Fundament der irreligiösen Kritik ist: Der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewußtsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewußtsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr enzyklopädisches Kompendium, ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Point-d’honneur [Ehrenpunkt], ihr Enthusiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner Trost- und Rechtfertigungsgrund. Sie ist die phantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist.
Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.“[viii]
Diese Passage, die den unvergesslichen Ausdruck „Opium des Volkes“ einführte, war eine ziemlich starke Medizin für die klerikalen reaktionären Regime der damaligen Zeit.
Journalismus, Politik und Exil
Dieser intellektuelle Fortschritt vollzog sich jedoch nicht in einem Vakuum. Bei der Rheinischen Zeitung machte Marx seine ersten Erfahrungen mit dem politischen Leben. Fünf Monate lang hielt er die Stelle des Redakteurs im ständigen Kampf gegen die Obrigkeit inne, bis ihn die preußische Zensur zum Rücktritt zwang. Er erlebte, wie nie zuvor, das betäubende Band feudaler Beschränkungen in Politik, Recht und Kultur und begann, die dahinterstehenden wirtschaftlichen Realitäten zu erkennen. Seine Politik war immer noch liberal und passte gut zu den aufstrebenden anti-aristokratischen und anti-klerikalen Fabrikanten, die die Zeitung finanzierten. Unter seiner Leitung wurde die Zeitung ein großer Erfolg: Die Zahl der Abonnenten stieg von 885 im Oktober 1841 auf 3.400 im März 1842. Marx wurde schnell zum führenden Geist der jungen Liberalen im Rheinland. Die folgenden Bemerkungen in einem Brief von Moses Hess an Auerbach müssen damals höchst außergewöhnlich erschienen sein – heute erscheinen sie als eine bemerkenswert treffende Prophezeiung:
„Sie werden sich freuen, hier einen Mann kennenzulernen der, auch wenn er in Bonn lebt, wo er bald Vorlesungen halten wird, zu unseren Freunden gehört. Er ist eine Persönlichkeit, die auf mich einen imposanten Eindruck gemacht hat, obwohl ich auf demselben Gebiet arbeite; kurz, Sie können sich darauf gefasst machen, dem größten, vielleicht dem einzigen lebenden wirklichen Philosophen zu begegnen; wenn er vor die Öffentlichkeit tritt (in seinen Schriften wie in seinen Vorträgen), wird er die Augen Deutschlands auf sich ziehen. Sowohl in seiner allgemeinen Tendenz als auch in der Struktur seines Denkens geht er nicht nur über Strauss, sondern auch über Feuerbach hinaus – und das heißt viel. Wenn ich in Bonn sein könnte, wenn er Vorlesungen hält, wäre ich sein eifrigster Schüler. Ich habe mir genauso einen Mann als meinen Philosophielehrer gewünscht. Jetzt fühle ich, was für ein Anfänger ich in der eigentlichen Philosophie bin. Aber Geduld! Ich werde jetzt anfangen, etwas zu lernen! Dr. Marx (so heißt mein Idol) ist noch ein sehr junger Mann (höchstens vierundzwanzig Jahre alt), der der mittelalterlichen Religion und Politik den Todesstoß versetzen wird; er verbindet den tiefsten philosophischen Ernst mit einem schneidenden Witz. Stellen Sie sich vor, Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine und Hegel in einer Person vereinigt: Ich sage vereint, nicht durcheinander – das ist Dr. Marx.“[ix]
Nach dem Verbot der Rheinischen Zeitung sah Marx für sich keine unmittelbare Zukunft mehr in Deutschland. Er ging mit seiner jungen Frau 1843 in die Schweiz und später nach Paris als Mitherausgeber der Deutsch-Französischen Jahrbücher, von denen nur eine Nummer erschien. Hier war es jedoch nicht die Zensur, sondern die Streitigkeiten zwischen den Flüchtigen, die das Erscheinen beendeten. Marx‘ Aufenthalt in Paris sollte nicht lange dauern; 1845 wurde er auf Antrag der preußischen Regierung ausgewiesen, unter anderem, weil er den Streik der schlesischen Weber unterstützt hatte. Zusammen mit Engels und anderen aktiven Sozialisten geht er nach Brüssel und nimmt sofort an den Bewegungen teil, die zu den großen Ereignissen von 1848 führen sollten.
Doch auch wenn sein Aufenthalt in Paris nur kurz war, sollte er eine entscheidende Etappe in seiner intellektuellen und politischen Entwicklung darstellen. Dank seines Vaters war er bereits von Kindesbeinen an mit der französischen Literatur vertraut, insbesondere mit der der großen Philosophen und Materialisten des 18. Jahrhunderts. Nun sollte er den lebendigen Einfluss der französischen Kultur und das neue Gedankengut der Liberalen, der utopischen Sozialisten der Schulen von St. Simon und Fourier und der Anhänger von Proudhon erleben.
Marx war beeindruckt, aber wurde selbst kein Anhänger. Seine solide deutsche philosophische Ausbildung, sein größeres Wissen und sein gesunder Menschenverstand machten ihn stattdessen zu einem scharfen und konstruktiven Kritiker. Er erkannte bereits, dass der Sozialismus nicht von oben kam. Schon in seinem ersten in Paris veröffentlichten Artikel, der bereits zitierten Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, erkennt er, dass die treibende Kraft der Umgestaltung der Gesellschaft das neue „Proletariat“ ist, das durch den Aufstieg der mechanischen Industrie entsteht. Die Aufgabe der Philosophie besteht darin, das Proletariat mit dem Wissen über seine eigene Natur und seine Möglichkeiten auszustatten. „Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. […] Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats, das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie.“
Friedrich Engels
Ein weiterer Einfluss von noch größerer Bedeutung sollte Marx in Paris erreichen. Im Jahr 1844 kam Friedrich Engels zu ihm nach Paris. Von da an wurden sie schnell Freunde und begannen eine intellektuelle Zusammenarbeit, die bis zu Marx‘ Tod andauern sollte. Engels brachte Erfahrungen und Kenntnisse mit, die für den vollständigen Aufbau des marxistischen Denkens unerlässlich waren – die Erfahrungen in England und die Kenntnisse der Ökonomie und der Naturwissenschaften. Marx hatte nur die relativ primitive und unentwickelte Industrie des Rheinlandes kennengelernt. Engels hatte als Teilhaber eines Baumwollunternehmens in Manchester die industrielle Produktion auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung gesehen und sich an ihr beteiligt.
Aus dem Ausland kommend, hatte er die britische Industrie nicht als selbstverständlich hingenommen: Er sah sie gleichzeitig als eine gigantische Kraft zur Umgestaltung der materiellen Bedingungen der Menschen und als ein soziales Muster, das die Menschen, Herren und Männer, die daran beteiligt waren, entwürdigte. Engels lernt die britische Arbeiterklasse, ihr Leben und ihre organisierten Kämpfe in einer Weise kennen, die er 1844 in seinem Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ verewigen sollte. Er sollte Marx in diese unmittelbare Erfahrung einführen und ihm die Theorien der britischen Ökonomen Adam Smith, Ricardo und Malthus nahebringen, die in der Atmosphäre der industriellen Revolution entwickelt worden waren. Er brachte auch ein wachsendes Wissen und Interesse an den Naturwissenschaften mit, dass in der Atmosphäre von Manchester, wo Wissenschaft und Industrie enger als anderswo miteinander verbunden waren, noch verstärkt wurde.
Es war die Kombination dieser Einflüsse, die Marx irgendwann im Jahr 1844 zu seiner philosophischen und politischen Synthese führen sollte, zu seiner großen Umkehrung von Hegel und der Ersetzung von Hegels ideeller und geistiger Grundlage durch eine reale materielle Grundlage. Wie er es viele Jahre später selbst erklärte:
„Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr direktes Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozeß, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg des wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle.“[x]
Die drei Hauptelemente des marxistischen Denkens – Materialismus, Ökonomie und Dialektik -, die hauptsächlich aus französischen, britischen und deutschen Quellen stammten, kamen zu dieser Zeit in einer großen Synthese zusammen.
Der Materialismus, den Marx auf diese Weise zum ersten Mal verkündete, unterschied sich von Anfang an stark von dem, der in der Tradition des 18. Jahrhunderts in Frankreich entstanden war, dem von Holbach und Lamettrie. Er war zugleich allgemeiner, logischer und zum ersten Mal ein historischer Materialismus. Seine Weiterführung führte Marx selbst, wie auch Engels, in die Bereiche der Naturwissenschaft. Marx interessierte sich für die Naturwissenschaft jedoch nicht nur aus dem philosophischen Grund, dass sie eine genauere Beschreibung der realen Welt lieferte, sondern auch aus einem ökonomischen Grund, nämlich wegen der engen Verbindung der Wissenschaft mit der Industrie in der Phase des sich rasch entwickelnden Kapitalismus.
Während Marx und Engels das Material bearbeiteten, das im Kommunistischen Manifest von 1848 die Welt erschüttern sollte, hatten sie die allgemeinen Linien des neuen dialektischen Materialismus bereits weitgehend festgelegt. Es stimmt, dass im „Kapital“ noch viel über die detaillierten wirtschaftlichen Abläufe des kapitalistischen Systems hinzugefügt werden sollte, aber was die Naturwissenschaft anbelangt, waren die Prinzipien bereits klar, als sie 1846 die „Deutsche Ideologie“ schrieben.
Revolution und Evolution
Marx stützte sich auf die Errungenschaften früherer Denker: auf den historisch-dialektischen Ansatz von Hegel, auf den impliziten Materialismus der Naturwissenschaftler, auf die ökonomische Analyse der klassischen Ökonomen Adam Smith und Ricardo. Aber er hat weit mehr getan, als eine Synthese ihrer Arbeiten zu erstellen, so großartig diese Leistung auch war. Sein Beitrag bestand vor allem darin, diese Masse an Analyse, Wissen und Kritik von einem Gegenstand der Betrachtung in einen Gegenstand des Handelns zu verwandeln. Diesen radikal neuen Schritt leitete er nicht aus einem philosophischen oder wissenschaftlichen System ab, sondern aus der Erfahrung der revolutionären Kämpfe des Volkes, an denen er sowohl als Teilnehmer als auch als Beobachter beteiligt war.
Dies kommt in einem Zitat aus Marx‘ polemischem Werk Das Elend der Philosophie (1846) zum Ausdruck, dass die Antwort auf Proudhons Philosophie des Elends war. Darin unterscheidet Marx scharf zwischen der Philosophie wohlmeinender philanthropischer bürgerlicher Doktrinäre und dem aus den Kämpfen des Proletariats erwachsenen realen praktischen Sozialismus:
„Wie die Ökonomen die wissenschaftlichen Vertreter der Bourgeoisklasse sind, so sind die Sozialisten und Kommunisten die Theoretiker der Klasse des Proletariats. Solange das Proletariat noch nicht genügend entwickelt ist, um sich als Klasse zu konstituieren, und daher der Kampf des Proletariats mit der Bourgeoisie noch keinen politischen Charakter trägt; solange die Produktivkräfte noch im Schoße der Bourgeoisie selbst nicht genügend entwickelt sind, um die materiellen Bedingungen durchscheinen zu lassen, die notwendig sind zur Befreiung des Proletariats und zur Bildung einer neuen Gesellschaft – solange sind diese Theoretiker nur Utopisten, die, um den Bedürfnissen der unterdrückten Klassen abzuhelfen, Systeme ausdenken und nach einer regenerierenden Wissenschaft suchen. Aber in dem Maße, wie die Geschichte vorschreitet und mit ihr der Kampf des Proletariats sich deutlicher abzeichnet, haben sie nicht mehr nötig, die Wissenschaft in ihrem Kopfe zu suchen; sie haben nur sich Rechenschaft abzulegen von dem, was sich vor ihren Augen abspielt, und sich zum Organ desselben zu machen. Solange sie die Wissenschaft suchen und nur Systeme machen, solange sie im Beginn des Kampfes sind, sehen sie im Elend nur das Elend, ohne die revolutionäre umstürzende Seite darin zu erblicken, welche die alte Gesellschaft über den Haufen werfen wird. Von diesem Augenblick an wird die Wissenschaft bewußtes Erzeugnis der historischen Bewegung, und sie hat aufgehört, doktrinär zu sein, sie ist revolutionär geworden.“[xi]
Marx hatte Hegels Vorstellung von der menschlichen Geschichte als eine Reihe von Entwicklungen übernommen, aber da er nun Materialist geworden war, sah er diese Entwicklungen nicht mehr als die einer Idee, sondern als die Entwicklung der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in der realen Welt. Mit der Erfahrung zweier Revolutionen in Frankreich im Rücken sah er die bedeutenden und entscheidenden Veränderungen der Geschichte nicht als langsame evolutionäre Transformationen, sondern als Veränderungen, die in schnellen Sprüngen erfolgten und den sukzessiven Aufstieg von Klassen an die politische Macht markierten, die besser in der Lage waren, die Produktivkräfte zu nutzen.
Bei der Untersuchung der menschlichen Geschichte ist der unumkehrbare Wandel nicht zu übersehen, und die Schwierigkeit besteht darin, die Existenz regelmäßiger Gesetze zu erkennen. Diese Bewegungsgesetze der menschlichen Geschichte wurden zuerst von Marx aufgezeigt. Später dehnte er sie auf die Welt der Natur und die des Menschen aus. Er schuf im modernen Sinne eine Naturgeschichte. Er erkannte, dass die statischen Vorstellungen von natürlichen und unveränderlichen Gesetzen und Ordnungen, die in der offiziellen Wissenschaft seiner Zeit vorherrschten, eine Mischung aus geistiger Trägheit und religiöser Ängstlichkeit waren. Er war eher geneigt, die evolutionären Ideen zu akzeptieren, die, obwohl sie damals suspekt waren, dank Darwin in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts dominant wurden. Seine Wertschätzung für Darwins „Über die Entstehung der Arten“ war unmittelbar, wenn auch nicht unkritisch; er war besonders kritisch gegenüber dem malthusianischen Aspekt des Kampfes ums Dasein. Er schreibt an Engels im Dezember 1860, also nur vier Wochen nach der Veröffentlichung:
„In meiner Prüfungszeit – während der letzten 4 Wochen – habe ich allerlei gelesen. U.a. Darwin’s Buch über „Natural Selection“. Obgleich grob englisch entwickelt, ist dies das Buch, das die naturhistorische Grundlage für unsere Ansicht enthält.“[xii]
Außerdem schrieb er an Lassalle im Jahr 1861:
„Sehr bedeutend ist Darwins Schrift und paßt mir als naturwissenschaftliche Unterlage des geschichtlichen Klassenkampfes. Die grob englische Manier der Entwicklung muß man natürlich mit in den Kauf nehmen. Trotz allem Mangelhaften ist hier zuerst der „Teleologie“ in der Naturwissenschaft nicht nur der Todesstoß gegeben, sondern der rationelle Sinn derselben empirisch auseinandergelegt.“[xiii]
Seitdem hat sich die Idee der Evolution mit ihren plötzlichen Veränderungen über die Welt der Organismen hinaus auf die Erde und das gesamte Universum ausgedehnt, wie sich Darwin nicht vorstellen konnte. Im Lichte der jüngsten Entdeckungen sind die Wissenschaftler heute eher bereit, die Phänomene der Natur als Prozesse und nicht als gegebene oder geschaffene Dinge zu akzeptieren. In intellektueller Hinsicht erweist sich Marx, der das alles schon vor hundert Jahren gesehen hat, als ein Geist ersten Ranges. Hätte er sich jedoch darauf beschränkt, eine materialistische historische Weltsicht zu begründen, hätte die Menschheit etwas verpasst, das viel größer ist als jede intellektuelle Konstruktion.
Die Philosophen müssen die Welt verändern
Marx‘ krönender Beitrag bestand in der Verknüpfung von Denken und Handeln. Diese neue Dimension der Philosophie ergab sich für ihn aus der Hegelschen Dialektik, die er auf ihre materielle Grundlage zurückführte, und aus der unmittelbaren Erfahrung des politischen Kampfes. Marx benutzte die Hegelsche Sprache sehr frei und mit großer Meisterschaft. In der Tat war er so sehr von Hegels Denk- und Ausdrucksmethode durchdrungen, dass ein großer Teil seines Frühwerks uns heute viel unverständlicher erscheinen muss als seinen Zeitgenossen. Dennoch stellt man beim Lesen und Wiederlesen von Marx fest, dass die Teile seines Werks, die manchmal als reiner Jargon bezeichnet werden, oft die bedeutendsten sind. Es ist reine Denkfaulheit von Wissenschaftlern, von denen viele nie auch nur eine Zeile von Marx gelesen haben, ihn abzulehnen, weil seine philosophischen Ausdrücke dem eher naiven Denkniveau von Naturwissenschaftlern außerhalb ihres eigenen spezifischen Wissenschaftsbereichs fremd sind. Viele der in dieser Vorlesung verwendeten Zitate sind gute Beispiele für die Prägnanz des Ausdrucks, die Marx durch die Verwendung des Hegelschen Modus erreichte. Dennoch war er in seinen Hauptwerken wie dem Kommunistischen Manifest oder dem Kapital stets darauf bedacht, seine Argumente, ohne jeglichen Hegel-Bezug darzulegen, selbst dort, wo er sich der Dialektik bediente, um zu seinen Ergebnissen zu gelangen.
Die Dialektik ist im Wesentlichen eine Philosophie der Veränderung und des Handelns. Marx nutzte sie, um zu zeigen, wie die spezifischen und schnellen Veränderungen, die in der realen und materiellen Welt tatsächlich stattfanden, zustande kamen. Seiner Ansicht nach sind solche Veränderungen nicht zufällig oder durch das Eingreifen geheimnisvoller äußerer Mächte entstanden. Sie mussten sich gerade wegen der Kämpfe und Widersprüche zwischen Elementen vollziehen, die ihrerseits das Produkt von Veränderungen in einem früheren Stadium waren. Marx hat sich sein ganzes Leben lang für das Wesen des Wandels interessiert. Dies zeigt sich sogar in seinen Arbeiten zur Mathematik,[4] wo er versucht, einen tiefen Einblick in die Differentialrechnung zu gewinnen, jenen Teil der Mathematik, der untersucht, wie sich eine Funktion von einem Wert zu einem anderen ändert und welche Eigenschaften sie an dem Punkt der Änderung hat.
Die Ausarbeitung der wichtigsten Konzepte des dialektischen Materialismus gehört zu den prägenden Jahren vor 1846. Sie kamen bereits in seinem frühen Aufsatz über Feuerbach zum Ausdruck (der zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht wurde, aber später in der „Die deutsche Ideologie“ erschien), der in der Passage seine erste Formulierung der Lehre vom historischen Materialismus enthält:
„[…] daß wir die erste Voraussetzung aller menschlichen Existenz, also auch aller Geschichte konstatieren, nämlich die Voraussetzung, daß die Menschen imstande sein müssen zu leben, um „Geschichte machen“ zu können. Zum Leben aber gehört vor Allem Essen und Trinken, Wohnung, Kleidung und noch einiges Andere. Die erste geschichtliche Tat ist also die Erzeugung der Mittel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse, die Produktion des materiellen Lebens selbst, und zwar ist dies eine geschichtliche Tat, eine Grundbedingung aller Geschichte, die noch heute, wie vor Jahrtausenden, täglich und stündlich erfüllt werden muß, um die Menschen nur am Leben zu erhalten.“[xiv]
Indem er über Feuerbach nachdachte, erkannte Marx die Beschränkung, die dieser Philosoph akzeptiert hatte, indem er das Streben nach Wissen auf „die Betrachtung der Wahrheit“ beschränkte.
An diesem Punkt formulierte er zum ersten Mal klar das Prinzip der Einheit von Denken und Handeln, von Theorie und Praxis, dass ihn von den idealistischen Abstraktionen Hegels zur konkreten und dynamischen realen Welt des dialektischen Materialismus führen sollte. Diese Ideen sind einem Millionenpublikum in aphoristischer Form in den Thesen über Feuerbach bekannt geworden. Sie stellen nicht nur seine Antwort auf Feuerbachs Wesen des Christentums dar, sondern auch auf sein späteres Werk Vorläufige Thesen zu einer Reform der Philosophie, das 1843 veröffentlicht wurde. Marx hatte sie ursprünglich als Notizen für seine eigene Anleitung gedacht, aber sie wurden in leicht veränderter Form von Engels als Anhang zu Ludwig Feuerbach und das Ergebnis der klassischen deutschen Philosophie 1889 veröffentlicht. Es lohnt sich, sie näher zu betrachten.
Die ersten beiden Thesen befassen sich mit der Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis:
I. „Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen mit eingerechnet) ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis; nicht subjektiv. Daher die tätige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus vom dem Idealismus – der natürlich die wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt – entwickelt. Feuerbach will sinnliche – von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedne Objekte: aber er faßt die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche Tätigkeit…“
II. „Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme – ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muß der Mensch die Wahrheit, i.e. die Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens – das von der Praxis isoliert ist – ist eine rein scholastische Frage.“[xv]
Hier zeigt sich Marx‘ Verständnis des wesentlich aktiven Charakters des Denkprozesses, der sich mit größter Kraft auf das organisierte Denken bezieht, das wir Wissenschaft nennen, sowohl die natürliche als auch die soziale. Die Wissenschaft, so behauptet er, ist immer mit der Veränderung der Natur für den menschlichen Gebrauch verbunden, und mit dem Verständnis der Natur nur insofern, als sie zu ihrer Veränderung genutzt werden kann. Dies schmälert natürlich in keiner Weise den spekulativen Wert der Wissenschaft, sondern erzwingt nur die Überprüfung durch materielle Tests und Nützlichkeit, um die Position der Wissenschaft zu jeder Zeit zu bestimmen. Wie wir wissen, gab und gibt es viele Pseudowissenschaften, von der Naturphilosophie und der Phrenologie zur Zeit von Marx bis zum Vitalismus und der Parapsychologie unserer Zeit. Diese Gedankensysteme haben einen gewissen, wenn auch begrenzten Wert als künstlerische Schöpfungen, aber sie halten dem Praxistest nicht stand und werden von Marx in den ideologischen Überbau verwiesen, der dazu verdammt ist, mit dem Gesellschaftssystem zu vergehen, das sie hervorgebracht hat.
Marx war sich völlig darüber im Klaren, dass alle Ideen, einschließlich der wissenschaftlichen Theorien, das Produkt des gesellschaftlichen Umfelds der jeweiligen Zeit sind und dass es keine absoluten oder ewigen Wahrheiten gibt, sondern eine Reihe relativer Wahrheiten, die jeweils ein immer größeres Verständnis und, was dieses Verständnis beweist, eine bessere Kontrolle der natürlichen Prozesse darstellen.
Gleichzeitig hatte er bereits den naiven sozialen Determinismus überwunden, der den Menschen nur als Produkt von Umständen sieht, auf die er keinen Einfluss hat. Dies zeigt sich deutlich in der dritten These:
III. „Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergißt, daß die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden muß. Sie muß daher die Gesellschaft in zwei Teile – von denen der eine über ihr erhaben ist – sondieren.
Das Zusammenfallen des Ändern[s] der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefaßt und rationell verstanden werden.“[xvi]
Diese These mit ihrer Betonung des Prozesses der „Erziehung des Erziehers“ kam dem Kern des Verständnisses des Ursprungs der Menschheit selbst nahe, das später von Engels in seinem Werk „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats“ so brillant entwickelt werden sollte.
In der vierten These erklärt Marx, wie die befreiende Analyse Feuerbachs, die die religiöse Welt als imaginären Reflex der realen gesellschaftlichen Welt zeigt, durch eine die reale Welt verändernde praktische Tätigkeit ergänzt werden muss. Die fünfte, sechste und siebte These verdienen es, in vollem Umfang zitiert zu werden:
V. „Feuerbach, mit dem abstrakten Denken nicht zufrieden, will die Anschauung; aber er faßt die Sinnlichkeit nicht als praktische menschlich-sinnliche Tätigkeit.“
VI. „Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Feuerbach, der auf die Kritik dieses wirklichen Wesens nicht eingeht, ist daher gezwungen:
1. von dem geschichtlichen Verlauf zu abstrahieren und das religiöse Gemüt für sich zu fixieren, und ein abstrakt – isoliert – menschliches Individuum vorauszusetzen;
2. Das Wesen kann daher nur als „Gattung“, als innere, stumme, die vielen Individuen natürlich verbindende Allgemeinheit gefaßt werden.“
VII. Feuerbach sieht daher nicht, daß das „religiöse Gemüt“ selbst ein gesellschaftliches Produkt ist und daß das abstrakte Individuum, das er analysiert, in Wirklichkeit einer bestimmten Gesellschaftsform angehört.“[xvii]
Hier sehen wir, wie sich aus der Kritik an Feuerbach ein neues soziologisches Prinzip herauskristallisiert, das den Menschen nicht als Summe von Individuen, sondern als „Gesamtheit der sozialen Beziehungen“ betrachtet. Diese Idee trifft die Wurzel der gesamten liberalen individualistischen Weltanschauung, die, wie Marx bereits gezeigt hatte, selbst Ausdruck des frühen Laissez-faire-Kapitalismus war. Zugleich ist sie weit davon entfernt, den Wert des Individuums zu leugnen, wie einige oberflächliche antimarxistische Kritiker bis heute behaupten. Die Erkenntnis, dass das Individuum nicht nur von der Gesellschaft geformt wird, sondern seinerseits die Gesellschaft schafft, macht es mehr und nicht weniger wichtig als das abstrakte Geschöpf oder den Wirtschaftsmenschen der christlichen oder liberalen Tradition.
In der achten bis elften These treibt Marx das Argument zu seiner logischen Schlussfolgerung:
VIII. „Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizism[us] veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis.“
IX. „Das Höchste, wozu der anschauende Materialismus kommt, d.h. der Materialismus, der die Sinnlichkeit nicht als praktische Tätigkeit begreift, ist die Anschauung der einzelnen Individuen und der bürgerlichen Gesellschaft.“
X. „Der Standpunkt des alten Materialismus ist die bürgerliche Gesellschaft; der Standpunkt des neuen die menschliche Gesellschaft, oder die gesellschaftliche Menschheit.“
XI. „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt drauf an, sie zu verändern.“[xviii]
Die letzten beiden Thesen mit dem inzwischen klassischen Konzept der vergesellschafteten Menschheit und dem Aufruf an die Philosophen, die Welt zu verändern, sind der Kern des gesamten Lebenswerks von Marx. Sie werden bereits so verwirklicht, wie er es voraussah und anstrebte.
Der Platz der Naturwissenschaften
In der gleichen Periode der Entwicklung seines Denkens war Marx zu jener umfassenden Einsicht in die Bedeutung und den Stellenwert der Naturwissenschaft gelangt, die sein gesamtes späteres Werk kennzeichnet. Dies wird bereits in einem seinen unveröffentlichten „Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844“ ausdrücklich festgestellt:
„Die Naturwissenschaften haben eine enorme Tätigkeit entwickelt und sich ein stets wachsendes Material angeeignet. Die Philosophie ist ihnen indessen ebenso fremd geblieben, wie sie der Philosophie fremd blieben. Die momentane Vereinigung war nur eine phantastische Illusion. Der Wille war da, aber das Vermögen fehlte. Die Geschichtsschreibung selbst nimmt auf die Naturwissenschaft nur beiläufig Rücksicht, als Moment der Aufklärung, Nützlichkeit, einzelner großer Entdeckungen. Aber desto praktischer hat die Naturwissenschaft vermittelst der Industrie in das menschliche Leben eingegriffen und es umgestaltet und die menschliche Emanzipation vorbereitet, sosehr sie unmittelbar die Entmenschung vervollständigen mußte. Die Industrie ist das wirkliche geschichtliche Verhältnis der Natur und daher der Naturwissenschaft zum Menschen; wird sie daher als exoterische Enthüllung der menschlichen Wesenskräfte gefaßt, so wird auch das menschliche Wesen der Natur oder das natürliche Wesen des Menschen verstanden, daher die Naturwissenschaft ihre abstrakt materielle oder vielmehr idealistische Richtung verlieren und die Basis der menschlichen Wissenschaft werden, wie sie jetzt schon – obgleich in entfremdeter Gestalt – zur Basis des wirklich menschlichen Lebens geworden ist, und eine andre Basis für das Leben, eine andre für die Wissenschaft ist von vornherein eine Lüge. (Die in der menschlichen Geschichte – dem Entstehungsakt der menschlichen Gesellschaft – werdende Natur ist die wirkliche Natur des Menschen, darum die Natur, wie sie durch die Industrie, wenn auch in entfremdeter[5] Gestalt wird, die wahre anthropologische Natur ist. –> Die Sinnlichkeit (siehe Feuerbach) muß die Basis aller Wissenschaft sein. Nur, wenn sie von ihr, in der doppelten Gestalt sowohl des sinnlichen Bewußtseins als des sinnlichen Bedürfnisses, ausgeht – also nur wenn die Wissenschaft von der Natur ausgeht –, ist sie wirkliche Wissenschaft. Damit der „Mensch“ zum Gegenstand des sinnlichen Bewußtseins und das Bedürfnis des „Menschen als Menschen“ zum Bedürfnis werde, dazu ist die ganze Geschichte die Vorbereitungs- Entwicklungsgeschichte. Die Geschichte selbst ist ein wirklicher Teil der Naturgeschichte, des Werdens der Natur zum Menschen. Die Naturwissenschaft wird später ebensowohl die Wissenschaft von dem Menschen wie die Wissenschaft von dem Menschen die Naturwissenschaft unter sich subsumieren: es wird eine Wissenschaft sein.“[xix]
In dieser stark komprimierten Aussage findet sich der Ausgangspunkt der marxistischen Analyse der Natur- und Menschenwelt, wie sie in Engels‘ Anti-Dühring, Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats und Dialektik der Natur, in Lenins Materialismus und Empiriokritizismus, in Stalins Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaft, sowie in vielen noch zu schreibenden Büchern zum Ausdruck kommt. Aus der obigen Passage wird deutlich, dass die Bedeutung, die Marx der Naturwissenschaft beimisst, auf ihrer Beziehung zur Industrie oder zum Ausdruck der gesellschaftlichen Produktivkräfte beruht. Denn, wie wir gesehen haben, hat er bereits verstanden, wie die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse – die Institutionen des Eigentums, des Marktes, der konkurrierenden oder monopolistischen Industrie – mit dem Zustand der Produktivkräfte verbunden sind. Diese hängen ihrerseits vom Stand der Wissenschaft ab und sind gleichzeitig ein wichtiges Motiv für deren Fortschritt oder Stagnation.
Die entscheidende Bedeutung der Entwicklung der Produktivkräfte zeigt sich darin, dass Marx darauf besteht, dass der Übergang zu einer neuen Art von Zivilisation, insbesondere zum Sozialismus, nur dann möglich ist, wenn die Produktivkräfte einen solchen Entwicklungsstand erreicht haben, dass sie die materiellen Möglichkeiten, d. h. die hohe Produktivität, bieten, die den Sozialismus zum Funktionieren bringen können, und dass erst dann der Kommunismus möglich sein wird.
Viel später, in der Kritik des Gothaer Programms (1875), kritisiert Marx scharf diejenigen, die meinen, es sei möglich, in einem sozialistischen Staat, der gerade aus dem Kapitalismus hervorgegangen ist, einen Zustand idealer Verteilungsgerechtigkeit zu erreichen.
„Aber diese Mißstände sind unvermeidbar in der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft nach langen Geburtswehen hervorgegangen ist. Das Recht kann nie höher sein als die ökonomische Gestaltung und dadurch bedingte Kulturentwicklung der Gesellschaft.
In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte {8} gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen – erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“[xx]
Diese Passage macht, wie kaum eine andere deutlich, wie gut Marx die Probleme des Übergangs zum Kommunismus verstanden hat. Wir können auch darüber nachdenken, wie gut die eigentlichen Erbauer des Sozialismus, Lenin und Stalin, dass damals von ihm aufgestellte Programm umgesetzt haben, während alle ihre „sozialistischen“ Gegner, die selbst nichts getan haben, um ihre eigenen Länder vom Kapitalismus zu befreien, schreien, dass die sowjetischen Machthaber den wahren Marxismus aufgegeben haben.
Marx erkannte voll und ganz, dass die Existenz der modernen Wissenschaft eine notwendige Voraussetzung für die mechanische Großindustrie ist und dass viele der spezifischen Merkmale dieser Industrie, vor allem Antriebsmaschinen wie die Dampfmaschine, die Wissenschaft sowohl für ihre Erfindung als auch für ihre Verbesserung benötigten. Andererseits ist er sich auch bewusst, dass die Wissenschaft keine spontane Schöpfung des menschlichen Geistes ist, nicht wie Athene, die mit voller Kraft dem Haupt des Zeus entspringt. Er sah, dass die Wissenschaft selbst ein Produkt der sozialen und industriellen Kräfte ist, denen sie dient. Wie er in Die deutsche Ideologie schrieb:
„…daß die vielberühmte „Einheit des Menschen mit der Natur“ in der Industrie von jeher bestanden und in jeder Epoche je nach der geringeren oder größeren Entwicklung der Industrie anders bestanden hat, ebenso wie der „Kampf“ des Menschen mit der Natur, bis zur Entwicklung seiner Produktivkräfte auf einer entsprechenden Basis. Die Industrie und der Handel, die Produktion und der Austausch der Lebensbedürfnisse bedingen ihrerseits und werden wiederum in der Art ihres Betriebes bedingt durch die Distribution, die Gliederung der verschiedenen gesellschaftlichen Klassen – und so kommt es denn, daß Feuerbach in Manchester z.B. nur Fabriken und Maschinen sieht, wo vor hundert Jahren nur Spinnräder und Webstühle zu sehen waren, oder in der Campagna di Roma nur Viehweiden und Sümpfe entdeckt, wo er zur Zeit des Augustus nichts als Weingärten und Villen römischer Kapitalisten gefunden hätte. Feuerbach spricht namentlich von der Anschauung der Naturwissenschaft, er erwähnt Geheimnisse, die nur dem Auge des Physikers und Chemikers offenbar werden; aber wo wäre ohne Industrie und Handel die Naturwissenschaft? Selbst diese „reine“ Naturwissenschaft erhält ja ihren Zweck sowohl wie ihr Material erst durch Handel und Industrie, durch sinnliche Tätigkeit der Menschen. So sehr ist diese Tätigkeit, dieses fortwährende sinnliche Arbeiten und Schaffen, diese Produktion die Grundlage der ganzen sinnlichen Welt, wie sie jetzt existiert, daß, wenn sie auch nur für ein Jahr unterbrochen würde, Feuerbach eine ungeheure Veränderung nicht nur in der natürlichen Welt vorfinden, sondern auch die ganze Menschenwelt und sein eignes Anschauungsvermögen, ja seine Eigne Existenz sehr bald vermissen würde.“[xxi]
Diese wechselseitige Beziehung zwischen Wissenschaft und Technik wurde später von Engels gut ausgedrückt, als er schrieb:
„Wenn die Technik, wie Sie sagen, ja größtenteils vom Stande der Wissenschaft abhängig ist, so noch weit mehr diese vom Stand und den Bedürfnissen der Technik. Hat die Gesellschaft ein technisches Bedürfnis, so hilft das der Wissenschaft mehr voran als zehn Universitäten. Die ganze Hydrostatik (Torricelli etc.) wurde hervorgerufen durch das Bedürfnis der Regelung der Gebirgsströme in Italien im 16. und 17. Jahrhundert. Von der Elektrizität wissen wir erst etwas Rationelles, seit ihre technische Anwendbarkeit entdeckt. In Deutschland hat man sich aber leider daran gewöhnt, die Geschichte der Wissenschaften so zu schreiben, als wären sie vom Himmel gefallen.“[xxii]
Darüber hinaus erkannte Marx, dass in jedem Gesellschaftszustand bis zu seiner Zeit die Theorien der Wissenschaft selbst keine absoluten und ewigen Ideen sind. Sie sind Teil der Ideologie der herrschenden Klasse der Zeit, in der sie entstanden sind, und sie werden aufrechterhalten und weiterentwickelt, um den Interessen dieser herrschenden Klasse zu entsprechen:
„Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche herrschende Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion, so daß ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken derer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. Die herrschenden Gedanken sind weiter Nichts als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken gefaßten herrschenden materiellen Verhältnisse; also der Verhältnisse, die eben die eine Klasse zur herrschenden machen, also die Gedanken ihrer Herrschaft. Die Individuen, welche die herrschende Klasse ausmachen, haben unter Anderem auch Bewußtsein und denken daher; insofern sie also als Klasse herrschen und den ganzen Umfang einer Geschichtsepoche bestimmen, versteht es sich von selbst, daß sie dies in ihrer ganzen Ausdehnung tun, also unter Anderm auch als Denkende, als Produzenten von Gedanken herrschen, die Produktion und Distribution der Gedanken ihrer Zeit regeln; daß also ihre Gedanken die herrschenden Gedanken der Epoche sind.“[xxiii]
So war im Mittelalter die Vorstellung einer statischen Weltordnung, die uns durch Dantes Divina Commedia vertraut ist, mit ihren von Engeln ständig gedrehten Himmelssphären und ihren Höllenkreisen ein Abbild der feudalen Ordnung von Papst, Kaiser, Königen und Adeligen, die alle von der Arbeit der Leibeigenen lebten. Später, als sich die Gesellschaftsordnung änderte und Geld das Maß aller Dinge war, als Schießpulver und Schifffahrt die Welt für Handel und Ausbeutung geöffnet hatten, war eine dynamischere Physik und ein dynamischeres Weltbild erforderlich. Der Wissenschaft wurde ein neuer Impuls und eine neue Richtung gegeben, die in erster Linie in der Astronomie und der Gravitationstheorie von Kopernikus, Galilei und Newton ihren Ausdruck fand.
Das Jahr der Revolutionen und „Manifest der Kommunistischen Partei“
Bisher habe ich mich nur mit der Leistung des jungen Marx befasst, bevor er in den Hauptteil seines politischen und wirtschaftlichen Lebenswerkes eingetreten war. Selbst auf diesem kleinen Raum ist es möglich, ein gewisses Maß an Reichtum und Kohärenz seiner Ideen zu erkennen. Dennoch hätten sie sicherlich nicht den überwältigenden Einfluss gehabt, den sie hatten, wenn Marx nicht gezwungen gewesen wäre, seine theoretische Arbeit für eine Weile zu verlassen und sich in die Welt der Aktion in den bewegenden Ereignissen von 1848 zu stürzen.
Dort zeigte eine bürgerliche Revolution in ihrem frühen Erfolg und ihrem noch schnelleren Scheitern und Verrat, wie die Kapitalistenklasse von einer fortschrittlichen und befreienden historischen Rolle beim Angriff auf die Relikte des Feudalismus zu einer Rolle übergegangen war, in der sie sich den reaktionären Kräften anschloss, um die neu entstehende industrielle Arbeiterklasse niederzuhalten. Dieser Klasse, dem Proletariat, dessen Rolle er zum ersten Mal klar erkannt hatte, widmete Marx seine ganze Aufmerksamkeit. Damals, auf dem Höhepunkt der revolutionären Welle, veröffentlichten er und Engels das Kommunistische Manifest. In dieses immer lebendige Dokument gossen sie in einer Sprache, die selbst ihre Feinde nur zu gut verstanden, die Früchte all ihrer Theorie und Erfahrung. Es ist bis heute die prägnanteste und klarste Darstellung der Überzeugungen und des Programms des Marxismus, wie er von nun an genannt werden sollte.
In jenen Tagen kehrten Marx und Engels in ihre rheinische Heimat zurück, um sich persönlich am Kampf zu beteiligen – Marx als Redakteur der kämpferischen und eine Zeit lang ungehinderten Neuen Rheinischen Zeitung, Engels als Offizier der republikanischen Freiwilligen. Die Episode war nur kurz, aber sie war ein Wendepunkt in beider Leben. Sie sollte in einem dauerhaften Exil in England enden und einen herzzerreißenden und scheinbar aussichtslosen Kampf des geschriebenen und gesprochenen Wortes gegen eine triumphierende und überschwängliche kapitalistische Ordnung beginnen, wie es sie nie zuvor gegeben hatte.
Doch dieser Kampf im Exil sollte sich auf lange Sicht als das fruchtbarste aller ihrer Unternehmungen erweisen. Gerade die Unwirksamkeit ihrer Position im Exil ermöglichte es ihnen, sich mit einer Gründlichkeit, für die sie nie zuvor Zeit gehabt hatten, auf die detaillierte Analyse des Kapitalismus in seinem charakteristischsten Aspekt – seiner wirtschaftlichen Struktur – zu konzentrieren.
Wissenschaft und Industrie im „Kapital“
Marx lernte seine Ökonomie im Zentrum des wirtschaftlichen Lebens der Welt seiner Zeit, in England, insbesondere in London und Manchester. In dem Maße, wie er sie sich aneignete, vermittelte sie ihm ein besseres Verständnis für alle anderen Aspekte von Kultur. Marx‘ Verständnis der Wissenschaft und ihrer Beziehung zum wirtschaftlichen und sozialen Wandel sollte sich im Laufe seines Lebens weiter vertiefen und wurde durch die neuen Erfahrungen mit praktischer Wissenschaft und Technik, die er in England machte, bereichert. Von den beiden war Engels derjenige, der den Techniken des Produktionsprozesses und dem allgemeinen Bereich der Naturwissenschaften näherstand:
„Marx und ich waren wohl ziemlich die einzigen, die aus der deutschen idealistischen Philosophie die bewußte Dialektik in die materialistische Auffassung der Natur und Geschichte hinübergerettet hatten. Aber zu einer dialektischen und zugleich materialistischen Auffassung der Natur gehört Bekanntschaft mit der Mathematik und der Naturwissenschaft. Marx war ein gründlicher Mathematiker, aber die Naturwissenschaften konnten wir nur stückweise, sprungweise, sporadisch verfolgen. Als ich daher durch Rückzug aus dem kaufmännischen Geschäft und Umzug nach London die Zeit dazu gewann, machte ich, soweit es mir möglich, eine vollständige mathematische und naturwissenschaftliche »Mauserung«, wie Liebig es nennt, durch, und verwandte den besten Teil von acht Jahren darauf.“[xxiv]
Dennoch arbeitete Marx selbst hart daran, sich die notwendigen grundlegenden und sogar praktischen Kenntnisse anzueignen. Zum Beispiel schrieb er an Engels:
„Ich füge etwas zu dem Abschnitt über Maschinen hinzu.[6] Hier gibt es einige Neugier erregende Fragen, die ich in meiner ersten Bearbeitung ignoriert habe. Um mir darüber Klarheit zu verschaffen, habe ich alle meine Hefte (Auszüge) über Technik noch einmal durchgelesen und besuche auch einen praktischen Kurs (nur experimentell) für Arbeiter bei Professor Willis (am Geologischen Institut in der Jermyn Street, wo auch Huxley seine Vorlesungen zu halten pflegte). Mit der Mechanik ist es für mich dasselbe wie mit den Sprachen. Ich verstehe die mathematischen Gesetze, aber die einfachste technische Realität, die Wahrnehmung verlangt, ist für mich schwieriger als für die größten Hohlköpfe.“[xxv]
Marx glänzte nie als Handwerker. Auf dem Höhepunkt seiner finanziellen Schwierigkeiten bekam er zwar eine Stelle als Bahnangestellter, konnte sie aber wegen seiner schlechten Handschrift nur wenige Tage behalten.
Durch die noch engere Zusammenarbeit mit Engels war Marx in der Lage, die tatsächlichen Prozesse der Industrie zu sehen und zu analysieren und sie im Detail mit ihren wirtschaftlichen Folgen in Beziehung zu setzen. Dies wird in seinem großen Werk „Das Kapital“ sehr deutlich, insbesondere in Kapitel XV des ersten Bandes über „Maschinen und moderne Industrie“ und in Kapitel V des dritten Bandes über „Ökonomien bei der Beschäftigung von konstantem Kapital“. Die einleitenden Passagen des ersten Buches sind in ihrer Klarheit und Durchdringung auch heute noch erstaunlich zu lesen. Marx zeigte ein Verständnis für das Wesen der mechanischen Produktion, das demjenigen aller anderen seiner Zeit weit voraus war. Man muss nur die Ideen eines sehr intelligenten und scharfsinnigen englischen Wissenschaftlers, Charles Babbage,[7] lesen, um den enormen Vorteil zu erkennen, den Marx aus seinem umfassenderen, philosophischen und wirtschaftlichen Ansatz zog. Wo Babbage nur einzelne Beispiele für den Einsatz von Maschinen sah, konnte Marx einen einzigen kontinuierlichen Umwandlungsprozess erkennen. Dieser Prozess begann mit dem Handwerker mit seinen Werkzeugen, ging über die Periode, die er als die der Manufaktur bezeichnete, in der eine Reihe von Handarbeiten zusammengefügt werden und in der eine Arbeitsteilung zu niedrigeren Kosten führt, bis hin zur modernen Industrie, in der die Maschine das Feld betritt.
Marx analysiert zunächst die Maschinerie der produktiven Industrie in allgemeiner Form:
„Alle entwickelte Maschinerie besteht aus drei wesentlich verschiednen Teilen, der Bewegungsmaschine, dem Transmissionsmechanismus, endlich der Werkzeugmaschine oder Arbeitsmaschine. Die Bewegungsmaschine wirkt als Triebkraft des ganzen Mechanismus. Sie erzeugt ihre eigne Bewegungskraft, wie die Dampfmaschine, kalorische Maschine, elektro-magnetische Maschine usw., oder sie empfängt den Anstoß von einer schon fertigen Naturkraft außer ihr, wie das Wasserrad vom Wassergefäll, der Windflügel vom Wind usw. Der Transmissionsmechanismus, zusammengesetzt aus Schwungrädern, Treibwellen, Zahnrädern, Kreiselrädern, Schäften, Schnüren, Riemen, Zwischengeschirr und Vorgelege der verschiedensten Art, regelt die Bewegung, verwandelt, wo es nötig, ihre Form, z.B. aus einer perpendikulären in eine kreisförmige, verteilt und überträgt sie auf die Werkzeugmaschinerie. Beide Teile des Mechanismus sind nur vorhanden, um der Werkzeugmaschine die Bewegung mitzuteilen, wodurch sie den Arbeitsgegenstand anpackt und zweckgemäß verändert. Dieser Teil der Maschinerie, die Werkzeugmaschine, ist es, wovon die industrielle Revolution im 18. Jahrhundert ausgeht. Sie bildet noch jeden Tag von neuem den Ausgangspunkt, sooft Handwerksbetrieb oder Manufakturbetrieb in Maschinenbetrieb übergeht.“[xxvi]
Dies führt ihn dazu, das wesentliche Merkmal einer Maschine darin zu sehen, dass es sich um ein Werkzeug handelt, das nicht von einem Menschen, sondern von einem mechanischen Apparat bedient wird:
„Die Werkzeugmaschine ist also ein Mechanismus, der nach Mitteilung der entsprechenden Bewegung mit seinen Werkzeugen dieselben Operationen verrichtet, welche früher der Arbeiter mit ähnlichen Werkzeugen verrichtete.
„Die Maschine, wovon die industrielle Revolution ausgeht, ersetzt den Arbeiter, der ein einzelnes Werkzeug handhabt, durch einen Mechanismus, der mit einer Masse derselben oder gleichartiger Werkzeuge auf einmal operiert und von einer einzigen Triebkraft, welches immer ihre Form, bewegt wird. Hier haben wir die Maschine, aber erst als einfaches Element der maschinenmäßigen Produktion.
„Die Erweitrung des Umfangs der Arbeitsmaschine und der Zahl ihrer gleichzeitig operierenden Werkzeuge bedingt einen massenhafteren Bewegungsmechanismus, und dieser Mechanismus zur Überwältigung seines eignen Widerstands eine mächtigere Triebkraft als die menschliche, abgesehn davon, daß der Mensch ein sehr unvollkommnes Produktionsinstrument gleichförmiger und kontinuierlicher Bewegung ist. Vorausgesetzt, daß er nur noch als einfache Triebkraft wirkt, also an die Stelle seines Werkzeugs eine Werkzeugmaschine getreten ist, können Naturkräfte ihn jetzt auch als Triebkraft ersetzen.“[xxvii]
Er sah die erste Phase der Maschinenindustrie nicht durch eine radikal neue Erfindung entstehen, sondern durch die Vervielfältigung einfacher handwerklicher Tätigkeiten, die durch einen Mechanismus wie den der Spinning Jenny oder des Crompton’s Mule verbunden waren. Seine Analyse der späteren Stadien der industriellen Entwicklung war noch tiefgreifender. Er zeigte, wie sie sich veränderte: erstens durch die Verschmelzung verschiedener Maschinen zu immer komplexeren Maschinen, die den Weg zu den kontinuierlichen, halb- oder vollautomatischen Prozessen ebneten, die wir als charakteristisch für die Industrie des zwanzigsten Jahrhunderts ansehen; und zweitens durch die Erweiterung der mechanischen Mittel, um Dinge zu tun, die mit den begrenzten Kräften des Menschen nicht möglich waren, insbesondere in der Schwerindustrie und der Eisen- und Stahlindustrie:
„Die moderne Industrie musste also selbst die Maschine, ihr charakteristisches Produktionsmittel, in die Hand nehmen und Maschinen durch Maschinen konstruieren. Erst dadurch schuf sie sich eine angemessene technische Grundlage und stand auf eigenen Füßen. Gleichzeitig mit dem zunehmenden Einsatz von Maschinen in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts wurde nach und nach auch die Herstellung von Maschinen selbst übernommen. Aber erst in der Dekade vor 1866 hat der Bau von Eisenbahnen und Ozeandampfern in gewaltigem Ausmaß die Zyklopenmaschinen hervorgebracht, die heute beim Bau von Antriebsmaschinen eingesetzt werden.“[xxviii]
Er erkannte außerdem, dass diese Entwicklung eine Verbindung zwischen Wissenschaft und Industrie herstellte und weitreichende soziale Folgen haben würde.
„Die Arbeitsmittel in Form von Maschinen erfordern die Ersetzung der menschlichen Kraft durch natürliche Kräfte und die bewusste Anwendung der Wissenschaft anstelle der Faustregel. In der Manufaktur ist die Organisation des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses rein subjektiv; sie ist eine Kombination von Einzelarbeitern; die moderne Industrie hat in ihrem Maschinensystem einen rein objektiven Produktionsorganismus, in dem der Arbeiter zum bloßen Anhängsel einer bereits bestehenden materiellen Produktionsbedingung wird. In der einfachen Kooperation und selbst in der arbeitsteiligen Kooperation erscheint die Verdrängung des isolierten Arbeiters durch den kollektiven Arbeiter immer noch mehr oder weniger zufällig zu sein. Die Maschinerie funktioniert, von einigen später zu erwähnenden Ausnahmen abgesehen, nur mit Hilfe von assoziierter oder gemeinsamer Arbeit. Daher ist der kooperative Charakter des Arbeitsprozesses im letzteren Fall eine technische Notwendigkeit, die durch das Instrument der Arbeit selbst diktiert wird.[xxix]
Marx konnte dieses funktionale Verständnis von Maschinen haben, weil er sie in jeder Phase mit ihrer tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzung verband. Er wies nach, dass der Grund für John Stuart Mills Klage, die Maschinen hätten „die tägliche Arbeit des Menschen nicht erleichtert“, darin lag, dass dies nie das Motiv der Erfindung im Kapitalismus gewesen war. Dieses Motiv sei zuallererst und zuletzt das des Profits gewesen. Die Funktion der technischen Verbesserung bestand in erster Linie darin, den Wert des Produkts bei gleicher Arbeitskraft zu erhöhen, und in zweiter Linie darin, die Profitrate zu steigern, indem die Menge an Rohstoffen, die in einer bestimmten Zeitspanne des Einsatzes von Maschinen und Anlagen verarbeitet wird, erhöht wird.
(Siehe die Erörterung in Kapital, Band III, Kapitel V.) Er zeigte ferner, dass paradoxerweise je arbeitssparender die Maschinen sind, desto mehr Menschen gewinnbringend zur Arbeit an ihnen herangezogen werden können. Die Entwicklung der Industrie hin zur Massenproduktion wird in diesem Abschnitt seines Werks sehr deutlich vorausgesagt.
Marx verstand auch gut, was die Wissenschaft bei der Entwicklung der modernen Industrie zu tun hatte. Die Forderung nach immer schnellerer und wirtschaftlicherer Arbeitsweise war eine Forderung, die durch die Verbesserung von Faustregeln nicht mehr erfüllt werden konnte.
„Diese Ersparungen in Anwendung des fixen Kapitals sind wie gesagt das Resultat davon, daß die Arbeitsbedingungen auf großer Stufenleiter angewandt werden, kurz, daß sie dienen als Bedingungen unmittelbar gesellschaftlicher, vergesellschafteter Arbeit oder der unmittelbaren Kooperation innerhalb des Produktionsprozesses. Es ist dies einesteils die Bedingung, worunter allein die mechanischen und chemischen Erfindungen angewandt werden können, ohne den Preis der Ware zu verteuern, und dies ist immer die conditio sine qua non. Andernteils werden erst bei großer Stufenleiter der Produktion die Ökonomien möglich, die aus der gemeinschaftlichen produktiven Konsumtion hervorfließen. Endlich aber entdeckt und zeigt erst die Erfahrung des kombinierten Arbeiters, wo und wie zu ökonomisieren, wie die bereits gemachten Entdeckungen am einfachsten auszuführen, welche praktischen Friktionen bei Ausführung der Theorie – ihrer Anwendung auf den Produktionsprozeß – zu überwinden usw.
Nebenbei bemerkt, ist zu unterscheiden zwischen allgemeiner Arbeit und gemeinschaftlicher Arbeit. Beide spielen im Produktionsprozeß ihre Rolle, beide gehn ineinander über, aber beide unterscheiden sich auch.
Allgemeine Arbeit ist alle wissenschaftliche Arbeit, alle Entdeckung, alle Erfindung. Sie ist bedingt teils durch Kooperation mit Lebenden, teils durch Benutzung der Arbeiten Früherer. Gemeinschaftliche Arbeit unterstellt die unmittelbare Kooperation der Individuen.
Das Obengesagte erhält neue Bestätigung durch das oft Beobachtete:
1. Den großen Unterschied in den Kosten zwischen dem ersten Bau einer neuen Maschine und ihrer Reproduktion, worüber Ure und Babbage nachzusehn.
2. Die viel größern Kosten, womit überhaupt ein auf neuen Erfindungen beruhendes Etablissement betrieben wird, verglichen mit den spätern, auf seinen Ruinen, ex suis ossibus <aus seinen Gebeinen> aufsteigenden Etablissements. Dies geht so weit, daß die ersten Unternehmer meist Bankrott machen und erst die spätem, in deren Hand Gebäude, Maschinerie etc. wohlfeiler kommen, florieren. Es ist daher meist die wertloseste und miserabelste Sorte von Geldkapitalisten, die aus allen neuen Entwicklungen der allgemeinen Arbeit des menschlichen Geistes und ihrer gesellschaftlichen Anwendung durch kombinierte Arbeit den größten Profit zieht.“[xxx] [Meine Kursive: J.D.B.]
So sah er diese universelle Arbeit, die Wissenschaft, als eine Komponente der Produktivkraft, die sich von der älteren kooperativen Arbeit unterscheidet und ihr im Kapitalismus gewissermaßen entgegensteht. Dies wird im „Kapital“ klar zum Ausdruck gebracht:
„Es ist ein Produkt der manufakturmäßigen Teilung der Arbeit, ihnen die geistigen Potenzen des materiellen Produktionsprozesses als fremdes Eigentum und sie beherrschende Macht gegenüberzustellen. Dieser Scheidungsprozeß beginnt in der einfachen Kooperation, wo der Kapitalist den einzelnen Arbeitern gegenüber die Einheit und den Willen des gesellschaftlichen Arbeitskörpers vertritt. Er entwickelt sich in der Manufaktur, die den Arbeiter zum Teilarbeiter verstümmelt. Er vollendet sich in der großen Industrie, welche die Wissenschaft als selbständige Produktionspotenz von der Arbeit trennt und in den Dienst des Kapitals preßt.“[xxxi]
Die Arbeiterklasse als Erbin der Wissenschaft
Aber wenn der Kapitalismus die Wissenschaft als Produktivkraft aufgebaut hat, so diente der Charakter der neuen Produktionsweise dazu, den Kapitalismus selbst überflüssig zu machen. Schon als Marx, in der Blütezeit des Kapitalismus schrieb, konnte er Anzeichen für dessen Verfall und den Beginn des Prozesses der monopolistischen Beschränkung erkennen, der seit seiner Zeit so ungeheuerlich gewachsen ist. Schon als Marx, in der Blütezeit des Kapitalismus schrieb, konnte er Anzeichen für dessen Verfall und den Beginn des Prozesses der monopolistischen Beschränkung erkennen, der seit seiner Zeit so ungeheuerlich gewachsen ist. Aber Marx wusste sehr wohl, dass der Kapitalismus, so überflüssig und verhängnisvoll er auch werden mochte, nicht von selbst verschwinden würde. Er würde auch nicht unmerklich in ein besseres System übergehen, wie wohlmeinende oder feige Liberale oder Sozialisten gerne glauben würden. Er wusste, dass die Wissenschaft erst dann ihren vollen sozialen Nutzen entfalten kann, wenn das Proletariat, die Klasse, die von der Industrie ins Leben gerufen wurde, selbst das Produktionssystem kontrolliert, das es bereits durch seine eigene kooperative Arbeit aufrechterhält. Marx sagte dies deutlich in seiner Rede, die er 1856 auf dem Jubiläumsessen der Volkszeitung hielt:
„Es gibt eine große Tatsache, die für dieses, unser neunzehntes Jahrhundert charakteristisch ist, eine Tatsache, die keine Partei zu leugnen wagt. Auf der einen Seite sind industrielle und wissenschaftliche Kräfte ins Leben getreten, die keine Epoche der bisherigen Menschheitsgeschichte je geahnt hat. Auf der anderen Seite gibt es Verfallserscheinungen, die die Schrecken aus den letzten Zeiten des Römischen Reiches weit übertreffen. In unseren Tagen scheint alles mit seinem Gegenteil behaftet zu sein; die Maschinen, die die wunderbare Kraft haben, die menschliche Arbeit zu verkürzen und zu befruchten, sehen wir verhungern und überanstrengen sie. Die neumodischen Quellen des Reichtums werden durch einen seltsamen Zauber in Quellen des Mangels verwandelt. Die Siege der Kunst scheinen durch den Verlust des Charakters erkauft. In dem Maße, in dem der Mensch die Natur beherrscht, scheint er von anderen Menschen oder von seiner eigenen Niedertracht versklavt zu werden. Selbst das reine Licht der Wissenschaft scheint nur auf dem dunklen Hintergrund der Ignoranz leuchten zu können.
Alle unsere Erfindungen und Fortschritte scheinen darauf hinauszulaufen, die materiellen Kräfte mit geistigem Leben auszustatten und das menschliche Leben zu einer materiellen Kraft zu verdummen. Dieser Gegensatz zwischen moderner Industrie und Wissenschaft auf der einen Seite, modernem Elend und Auflösung auf der anderen Seite, dieser Gegensatz zwischen den Produktivkräften und den sozialen Verhältnissen unserer Epoche ist eine Tatsache, offenkundig, überwältigend und nicht anfechtbar. Die einen mögen darüber jammern, die anderen mögen die modernen Künste abschaffen wollen, um die modernen Konflikte zu beseitigen. Oder sie mögen sich einbilden, dass ein so deutlicher Fortschritt in der Industrie durch einen ebenso deutlichen Rückschritt in der Politik ergänzt werden will. Wir verkennen nicht die Form des klugen Geistes, der all diese Widersprüche weiterhin prägt. Wir wissen, dass die neumodischen Kräfte der Gesellschaft, um gut zu funktionieren, nur von neumodischen Menschen beherrscht werden wollen – und das sind die arbeitenden Menschen. Sie sind ebenso eine Erfindung der modernen Zeit wie die Maschinen selbst. In den Zeichen, die den Mittelstand, die Aristokratie und die armen Propheten des Rückschritts verwirren, erkennen wir unseren tapferen Freund, Robin Goodfellow, den alten Maulwurf, der so schnell in der Erde arbeiten kann, den würdigen Pionier der Revolution. Die englischen Arbeiter sind die erstgeborenen Söhne der modernen Industrie. Sie werden dann gewiss nicht die letzten sein, die der sozialen Revolution, die diese Industrie hervorbringt, zur Seite stehen, einer Revolution, die die Emanzipation ihrer eigenen Klasse in der ganzen Welt bedeutet, die so universell ist wie die Herrschaft des Kapitals und die Lohnsklaverei.“[xxxii]
Darin hebt Marx sowohl die Bedeutung der Wissenschaft als auch die Tatsache hervor, dass sie nur durch die Arbeiterklasse effektiv genutzt werden kann. Das wesentliche Merkmal der modernen Industrie, wie er es sah – die gesellschaftliche Produktion von Wert -, kann nicht effektiv funktionieren, wenn sie nicht von der gesellschaftlichen Verwertung der produzierten Werte begleitet wird. Die einzigen, die diese soziale Verwertung sicherstellen können, sind die Menschen, die unter dem gegenwärtigen System leiden und die selbst die Haupttriebkraft dieses Systems sind – die Industriearbeiter.
Marx deutet hier ein Produktionssystem an, das weitaus bewusster von den Menschen kontrolliert wird als alles, was der Kapitalismus hervorbringen könnte. In dieser Kontrolle sieht er die Möglichkeit, Ergebnisse zu erzielen, die in dem ständigen Streben nach Profit, das alles konstruktive Unternehmertum vereitelt, und in der durch die Bedingungen des Marktes erzwungenen Anarchie der Produktion unmöglich sind. Diese soziale Kontrolle ist also selbst eine Bedingung der Freiheit. Zu diesem Zweck forderte Marx die Arbeiterklasse auf, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und den bürgerlichen Staat zu stürzen.Erst dann würde die „eine Wissenschaft“, die Natur- und Humanwissenschaft umfasst, in der Praxis wie in der Theorie Gestalt annehmen können. In diesem wie in allen anderen Bereichen, in der Philosophie wie in der Politik, hat Marx sein ganzes Leben lang die Zukunft mit der Gegenwart verwoben. Er hat die Verwirklichung seiner Prophezeiung sowohl vorausgesehen als auch sichergestellt.
Das Erbe von Marx
Wenn wir nun auf die Jahre seit Marx‘ Tod zurückblicken, sollten wir in der Lage sein, etwas von der Bedeutung seines Verständnisses der Beziehungen zwischen Wissenschaft, Produktion und politischen Formen zu erkennen. Doch wie wenige Intellektuelle mit ihrem Wissen und der Erfahrung der großen und schrecklichen Ereignisse unserer Zeit haben dies auch nur ansatzweise getan! Die Mehrheit der Intellektuellen seiner eigenen Zeit hat dies sicherlich nicht getan. Die meisten der „gebildeten“ Wissenschaftler, die, ob sie wollten oder nicht, Teil des Produktionsmechanismus waren, die Ökonomen und Philosophen, die dafür bezahlt wurden, den ideologischen Hintergrund des kapitalistischen Systems zu vermitteln, waren nicht in der Lage, den Marxismus zu widerlegen, weil sie nicht in der Lage waren, ihn überhaupt zu betrachten, geschweige denn, ihn zu verstehen. Die marxistischen Ideen verbreiteten sich in der Arbeiterklasse, die als einzige in der Lage war, aus ihrer eigenen Lebenserfahrung heraus die wesentlichen Merkmale dieser Philosophie zu erkennen, und insbesondere die Notwendigkeit, in jeder Phase ihr Verständnis mit ihrem Handeln zu verbinden.
Marx selbst war der erste, der die Gesetze der Transformation der menschlichen Gesellschaft darlegte. Von dem Moment an, als er dies tat, wurde er zu einem aktiven Führer der Arbeiterklasse.
Dieser Aspekt seiner Tätigkeit, der durch ein wachsendes klassenbewusstes Proletariat vermittelt wurde, sollte sich als wirksames Mittel erweisen, um die Aufgabe der „Veränderung der Welt“ zu erfüllen, die er selbst den Philosophen gegeben hatte. Lafargue hatte tatsächlich geschrieben:
„Karl Marx war einer jener seltenen Männer, die sowohl in der Wissenschaft als auch im öffentlichen Leben an vorderster Front stehen können. Er hat diese beiden Bereiche so eng miteinander verbunden, dass wir ihn nie verstehen werden, wenn wir ihn nicht gleichzeitig als Mann der Wissenschaft und als sozialistischen Kämpfer betrachten. Er war zwar der Meinung, dass jede Wissenschaft um ihrer selbst willen gepflegt werden muss und dass man sich bei der Durchführung wissenschaftlicher Forschungen keine Gedanken über die möglichen Folgen machen sollte, doch vertrat er die Ansicht, dass der Gelehrte, wenn er sich nicht selbst erniedrigen will, niemals aufhören darf, sich an den öffentlichen Angelegenheiten zu beteiligen – dass er sich nicht in sein Arbeitszimmer oder sein Laboratorium zurückziehen darf, wie eine Made in den Käse, und dass er die sozialen und politischen Kämpfe seiner Zeitgenossen meiden muss. Die Wissenschaft darf kein egoistisches Vergnügen sein. Diejenigen, die das Glück haben, sich der Wissenschaft widmen zu können, sollten die ersten sein, die ihr Wissen in den Dienst der Menschheit stellen. Einer seiner Lieblingssprüche lautete: ‚Arbeite für die Welt‘.“[xxxiii]
Marx machte kein Geheimnis aus seiner Lehre, sie war für alle, auch für die Kapitalisten, zu lesen und zu verstehen. Dennoch wurden seine Prophezeiungen nicht beachtet, obwohl sie sich nach und nach erfüllten. Die herrschende Klasse konnte sie nicht verstehen, weil sie sich dem logischen Bild, das sie offenbarten, nicht stellen konnte. Und doch waren sie gezwungen, sie auszuführen, sogar bis zu ihrer eigenen Zerstörung.
Im Laufe des Jahrhunderts seit Marx‘ erster Analyse des Kapitalismus und vor allem durch die Nutzung der Wissenschaft haben sich die Produktionsmethoden in ihrer Effizienz enorm verbessert. Doch diese große Steigerung der Produktivkraft hat die Schwierigkeiten und Widersprüche des Kapitalismus nicht im Geringsten vermindert. Im Gegenteil, wie wir alle aus bitterer Erfahrung wissen, hat er sie sogar noch vergrößert. Von 1850 bis 1950 waren wir Zeugen von Krisen, die an Tiefe und Dauer zunahmen und sich in Kriegen und reaktionären Tyranneien entluden, die schlimmer waren als alles, was sich irgendein Ökonom oder Historiker aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hätte vorstellen können. Aber wir haben auch die praktische Verwirklichung der positiveren Prophezeiungen von Marx miterlebt, nämlich die Gründung des ersten sozialistischen Staates, der Sowjetunion, die trotz aller Widerstände und Angriffe wachsen und gedeihen konnte. Und um sie herum wachsen nun in West und Ost andere Staaten, die von der gleichen schöpferischen Philosophie durchdrungen sind.
Wissenschaft im Imperialismus – Frustration und Militarisierung
Auch in dieser Zeit hat die Wissenschaft enorme und progressive Veränderungen erfahren. Unser Wissen über das Universum im Jahr 1950, das unbelebte und das belebte, und damit auch unsere Möglichkeiten, die Natur zu kontrollieren, sind fast unermesslich größer als im Jahr 1850. Dennoch wäre es absurd zu behaupten, dass es deshalb heute allen Menschen besser geht als damals und sie frei von Sorgen sind. Alles, was geschehen ist, ist, dass die Kluft zwischen dem, was für die Menschheit getan wird, und dem, was durch die Wissenschaft für sie getan werden könnte, viel größer geworden ist. Die Wissenschaft erscheint dem Wissenschaftler wie auch dem normalen Bürger nicht mehr als eine hoffnungsvolle und nutzbringende Kraft, sondern als etwas, das willkürlich für zunehmend sinnlose oder zerstörerische Zwecke eingesetzt wird. Es wird immer schwieriger, sich die Wissenschaft losgelöst von der Gesellschaft vorzustellen. Die indirekte Kontrolle durch Wohltaten und staatliche Zuschüsse, die durch die Doktrin der reinen Wissenschaft gut verborgen ist, kann nicht mehr in dem geforderten Umfang funktionieren. In den kapitalistischen Ländern werden die Wissenschaftler heute direkt von den Regierungen oder von Monopolen kontrolliert, und das oft auf eine besonders unangenehme Weise. In der Tat hat sich dieser Prozess seit dem Krieg so stark beschleunigt, dass die meisten Wissenschaftler immer noch völlig fassungslos dastehen.
Mit der zunehmenden Komplexität der Wissenschaft sind ihre Kosten in einem Maße gestiegen, das sie fast vollständig von staatlicher oder monopolistischer Unterstützung abhängig macht. Diese Unterstützung wird nun zunehmend direkt oder indirekt für militärische Zwecke gewährt. Bereits über 80 Prozent der staatlichen Ausgaben für die Wissenschaft sowohl in Großbritannien als auch in den Vereinigten Staaten werden für Kriegszwecke aufgewendet. Dieser Anteil steigt nun so schnell, dass die Forschung zum Wohle der Menschen in rückständigen Ländern und sogar in fortgeschrittenen Industrieländern stagniert oder sogar zurückgefahren wird.
Ebenso ärgerlich für den einzelnen Wissenschaftler ist die Wirkung der Geheimhaltung – eine unvermeidliche Begleiterscheinung der Nutzung der Wissenschaft für militärische Zwecke. Alle alten Gemeinplätze der Wissenschaft, die Ideen der freien Forschung und der freien Veröffentlichung werden allmählich ausgehöhlt,[8] und an ihre Stelle tritt ein System der Inspektion und der polizeilichen Überwachung, mit den Sanktionen der Entlassung oder der Inhaftierung, die die modernen Wissenschaftler kaum freier machen als die teuer ausgebildeten kultivierten griechischen Sklaven der römischen Zeit.
Diese Kontrolle unter dem Deckmantel der „Sicherheit“ beschränkt sich nicht nur auf die Forschung, sondern erstreckt sich auch auf die politische Meinung und sogar auf das wissenschaftliche Denken selbst.[9] In den Vereinigten Staaten und in allen Ländern, die sie beherrschen, wird es für jeden, der nicht die entsprechenden Überzeugungen hat, immer schwieriger, überhaupt wissenschaftlich zu arbeiten. Loyalitätseide und politische Tests werden immer mehr zu den Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Tätigkeit in Forschung und Lehre.[10] Die wesentliche Bedingung ist, dass der Empfänger wissenschaftlicher Mittel in keiner Weise kritisieren darf, was mit den Ergebnissen seiner Arbeit geschieht, und dass er einen absoluten Glauben an die Richtigkeit der Maßnahmen seiner Regierung haben muss. Das Gleiche könnte auch hier geschehen, wenn es nicht auf den massiven Widerstand der Wissenschaftler und der Bevölkerung Großbritanniens stößt.
Natürlich ist es für eine Reihe von Menschen nicht sehr schwierig, sich diesen Bedingungen zu unterwerfen, aber diese Unterwerfung erfolgt zu einem sehr hohen Preis.[11] Sie verstärkt die bereits sehr starke Sanktion, die in der kapitalistischen Gesellschaft seit ihrem Beginn gegen jede Art von Untersuchung besteht, die die Grundlagen der kapitalistischen Wirtschaft und die Struktur der Gesellschaft selbst kritisieren könnte. Dies führt zu einer Art anerzogener und automatischer Dummheit.
Niemals zuvor, nicht einmal auf dem Höhepunkt der Reaktion auf die Französische Revolution, war konventionelles Denken mit einer Tendenz zu mystischem und religiösem Glauben in der Wissenschaft stärker verbreitet. Ein solches Denken ist heute für „angesehene“ Wissenschaftler fast schon obligatorisch, und diejenigen, für die es selbstverständlich ist, werden gerne in die höchsten Ämter befördert.[12]
Gerade in einer Zeit, in der die innere Entwicklung der Wissenschaft selbst immer deutlicher auf die Einheit aller Wissenschaften und auf die engen Beziehungen zwischen der Wissenschaft und den wirtschaftlichen und historischen Prozessen hinweist, wird es zu einer Glaubensfrage, dass die Wissenschaft als vollkommen frei und unabhängig von diesen Prozessen betrachtet werden muss.
Gerade in einer Zeit, in der die Wissenschaft, von der Physik bis zur Biologie, von der im Wesentlichen marxistischen Idee der historischen und dialektischen Transformation durchdrungen ist, wird es zur gefährlichen Ketzerei, überhaupt an solche Veränderungen zu glauben.
In der Tat ist das Kriterium für den Erfolg in der Wissenschaft das Eingeständnis völliger ‚und blanker Unwissenheit, wofür ein großartiges Beispiel in einem Buch von Dr. Vannevar Bush, dem Direktor der militärischen wissenschaftlichen Forschung in den Vereinigten Staaten während des Krieges, geliefert wurde:
„Doch die ganze Angelegenheit ist ein grässlicher Irrtum. Die Wissenschaft wurde falsch verstanden. Die Wissenschaft schließt den Glauben nicht aus. Und der Glaube allein kann der Bedrohung begegnen, die jetzt über uns schwebt.
„Die Wissenschaft lehrt keinen strengen Materialismus. Sie lehrt überhaupt nichts, was über ihre Grenzen hinausgeht, und diese Grenzen sind durch die Wissenschaft selbst stark begrenzt.
„Die Wissenschaft baut große Teleskope, um die Sehkraft des Menschen zu erweitern…, aber sie untersucht nicht, wie der Kosmos zuerst erschienen ist, um darüber nachzudenken. Noch mehr schweigt sie darüber, ob es bei der Erschaffung des Kosmos einen großen Zweck gab, der über das Verständnis des schwachen menschlichen Geistes hinausgeht. Diese Dinge sind für immer jenseits seines Verstandes.
„Die Wissenschaft baut Mikroskope, um in das Innere der Materie vorzudringen.
„Sie spekuliert darüber, ob alles Ursache und Wirkung ist oder ob es ein Element der Wahrscheinlichkeit und des Zufalls gibt, sogar in der Wechselbeziehung der physischen Dinge. Aber wenn es um den Grund geht, warum diese Kräfte existieren, was ihre letzte Natur ist, wie sie entstanden sind, hält es inne. Diese Dinge liegen jenseits seines Wissens.
„Die Wissenschaft betrachtet das Leben.
„Sie zeichnet die Entwicklung von der Urzelle unter der Sonne zu einem System organischen Lebens nach, das im Menschen gipfelt, und sie lehrt den Menschen, wie er am besten mit seiner Umwelt zurechtkommt. Aber sie spekuliert nicht darüber, wie die beteiligten Materialien und Prozesse letztendlich zustande gekommen sind, oder ob sie zufällig waren oder ausdrücklich dazu bestimmt waren, einen Menschen hervorzubringen. Diese Dinge liegen jenseits ihres Wissens.
„Die Wissenschaft erforscht den Geist des Menschen selbst…. Aber sie definiert weder das Bewusstsein noch sagt sie uns, warum es ein Wesen auf der Erde gibt, das begründen kann, warum es dort ist.
Sie äußert sich nicht dazu, ob es so etwas wie einen freien Willen gibt, eine Wahl von Handlungen, die über das hinausgehen, was durch die Mechanismen diktiert wird. Sie befasst sich nicht mit dem Glauben. Diese Dinge liegen jenseits ihres Wissens.“[xxxiv]
Die Ironie der Situation ist, dass all dieser Obskurantismus und diese Reaktion als Teil der „Freiheit der Wissenschaft“ und der „westlichen Zivilisation“ dargestellt werden. Sogar die Geschichte kann in einem solchen Ausmaß pervertiert werden, dass die katholische Kirche als Schirmherrin und Förderin des wissenschaftlichen Fortschritts als Teil der christlichen Zivilisation dargestellt wird. Und das, obwohl sie während des größten Teils ihrer Geschichte ihr Bestes getan hat, um zu verhindern, dass die Wissenschaft überhaupt außerhalb eines festen dogmatischen Schemas existiert.
Mit dieser Reaktion geht ein tiefsitzender Pessimismus in Bezug auf die Möglichkeiten des Einsatzes der Wissenschaft zur Verbesserung der Menschheit einher. Man kehrt zu den malthusianischen Vorstellungen von der Überbevölkerung und der Begrenztheit der Ressourcen der Welt zurück. Vieles an dieser Agitation verbirgt ziemlich schlecht die grundlegende bürgerliche Angst, dass die Menschen – die „minderwertigen“ Massen, die Neger, die Orientalen – die über ihnen Stehenden von ihren privilegierten Plätzen verdrängen werden. Sie geht unmerklich in die Ethnie-Theorie der Faschisten über und wird, wenn ihr nicht Einhalt geboten wird, erneut zu Krieg und Massenvernichtung führen. Die zerstörerischen Elemente in der Wissenschaft werden gepriesen, die schöpferischen verunglimpft.[13]
Die neue sozialistische Welt – Wissenschaft für das Volk
Glücklicherweise gibt es dank Marx eine andere Seite des Bildes, zuerst in der Theorie, jetzt in der Praxis. Bereits 1843 hatte Engels die Theorie der abnehmenden Produktivität des Bodens in Frage gestellt:
„Die Ausdehnung des Landes ist begrenzt. Nun gut. Die Menge der Arbeitskraft, die auf diese Fläche angewandt werden muss, wächst mit der Bevölkerung; nehmen wir sogar an, dass die Zunahme des Ertrags nicht immer proportional zur Zunahme der Arbeit ist; dennoch bleibt ein dritter Faktor – der bei den Ökonomen nie etwas zählt, das ist wahr -, nämlich die Wissenschaft, und der Fortschritt der Wissenschaft ist so grenzenlos und mindestens so schnell wie der der Bevölkerung. Wie viel des Fortschritts in der Landwirtschaft in diesem Jahrhundert ist allein der Chemie zu verdanken, und tatsächlich nur zwei Männern – Sir Humphrey Davy und Justus Liebig?
Aber die Wissenschaft vervielfältigt sich mindestens so sehr wie die Bevölkerung: Die Bevölkerung wächst im Verhältnis zur Zahl der letzten Generation; die Wissenschaft macht Fortschritte im Verhältnis zur Gesamtmenge des Wissens, das ihr von der letzten Generation hinterlassen wurde, und daher unter den gewöhnlichsten Bedingungen auch in geometrischer Progression – und was ist für die Wissenschaft unmöglich? Aber es ist lächerlich, von Überbevölkerung zu sprechen, während es im Tal des Mississippi genug brachliegendes Land gibt, um die gesamte Bevölkerung Europas darauf zu verpflanzen, und während im Allgemeinen nur ein Drittel der Erdoberfläche als kultiviert angesehen werden kann und die Produktion dieses dritten Teils selbst durch die Anwendung selbst der bereits bekannten verbesserten Methoden um das Sechsfache und mehr gesteigert werden könnte.“[xxxv]
Heute ist dies nicht nur ein begründeter Optimismus, sondern eine Tatsache. Eine neue Welt ist entstanden. Es gibt 800.000000 Menschen, die im Sozialismus leben. Die Ideen von Marx und Engels haben im Denken und Wirken von Lenin und Stalin eine würdige Weiterentwicklung gefunden. Mit dem Schlüssel der Dialektik und der Erfahrung des revolutionären Kampfes haben sie die erste Bresche in die Weltherrschaft des Kapitalismus geschlagen. Es gelang ihnen, weil sie dank Marx die Wirkungsgesetze der gesellschaftlichen Kräfte und vor allem die Rolle des Proletariats als führende Kraft der Revolution verstanden.
Jetzt, in unserer Zeit, nach einer weiteren Weltkatastrophe, die durch die wahnsinnige Gier und Gewalt des zerfallenden Kapitalismus verursacht wurde, ist das Lager des Sozialismus noch breiter geworden. In den Volksdemokratien Europas ist die jahrhundertealte Herrschaft der Großgrundbesitzer vorbei, und die natürlichen Talente des Volkes können sich zum ersten Mal entfalten. In China ist der Wandel nicht weniger bedeutend. Unter der Führung von Mao Tsetung hat sich dieses große Volk aus der doppelten Unterdrückung durch den ausländischen Imperialismus und den einheimischen Feudalismus an die Spitze der sozialen Errungenschaften der Menschheit katapultiert. In all diesen Ländern werden die ursprünglichen Ideen von Marx über das Verhältnis von Wissenschaft und Produktivkräften in guter Übereinstimmung mit ihren lokalen und nationalen Besonderheiten in die Praxis umgesetzt. ie wesentlichen Ergebnisse dieses Programms sind erstens, dass die Wissenschaft die Aufgabe erhält, zur Befriedigung der feststellbaren menschlichen Bedürfnisse nach Nahrung, Unterkunft, Produktions- und Transportmitteln beizutragen. Zweitens, dass die Wissenschaft aufhört, etwas vom Rest der gesellschaftlichen Aktivitäten und einer intellektuellen Elite Vorbehaltenes zu sein, und Teil des täglichen Lebens und der Arbeit der großen Mehrheit der Bevölkerung wird.
Dies ist ein großer Unterschied zur Situation im Kapitalismus. Im Kapitalismus ist die Wissenschaft in akademischen Kreisen auf verwässerte und unkoordinierte Beiträge zum Verständnis der Natur beschränkt. In der Praxis wird sie dort eingesetzt, wo es profitabel ist oder wo sie tödliche Waffen produzieren kann. Man weigert sich strikt, die Wissenschaft als Ganzes zu betrachten und ihre verschiedenen Teile in einen umfassenden Plan zur Verbesserung der Menschheit einzubinden. Ein solcher Plan wäre in einem kapitalistischen Land in der Tat völlig unsinnig, denn es wäre absurd, auch nur an eine Planung der Wissenschaft zu denken, wenn die Produktion selbst den Launen des Privateigentums und des Monopols unterworfen bleibt, das sie außer für militärische Zwecke einschränkt. In einem sozialistischen Staat ist diese Beschränkung jedoch aufgehoben, und die Wissenschaft nimmt ganz natürlich ihren Platz als normales Mittel zur kontinuierlichen und progressiven Verbesserung der Produktivität ein.
Die sozialistische Wissenschaftsplanung wird oft verzerrt und als Versuch karikiert, Gedanken und Erfindungen im Voraus zu planen. Ein solcher Versuch wurde nie unternommen, und wenn dies die beste Nutzung der Wissenschaft gewesen wäre, hätte die Sowjetunion angesichts der enormen anfänglichen Armut und der wiederholten bewaffneten Intervention des Auslands unmöglich die Ergebnisse in Frieden und Krieg erzielen können, die sie erzielt hat. Was in der Sowjetunion und in den neuen Demokratien tatsächlich geschieht, ist, dass die Wissenschaft zur Lösung von Problemen eingesetzt wird, die sich aus dem allgemeinen Wirtschaftsplan ergeben. Zum Beispiel studieren bei den großen kombinierten Plänen für den Südosten der Sowjetunion, die das gesamte Gesicht der Natur verändern und hundert Millionen Menschen ernähren sollen, einige Tausende von Wissenschaftlern der verschiedensten Kategorien, von Mathematikern bis zu Archäologen, an Ort und Stelle und in ihren Laboratorien die Vielzahl von Problemen, die formuliert und gelöst werden müssen.[14]
Aufgrund der Kenntnis der Bedürfnisse des Landes und der Erfahrung der tatsächlichen Zusammenarbeit bei Bauarbeiten sind die Wissenschaftler in der Lage, einzeln und gemeinsam zu bestimmen, welche Forschungsrichtungen am fruchtbarsten sein könnten, und können ihre Arbeit in diese Richtungen lenken.
Dies setzt sowohl eine breitere als auch eine tiefere Nutzung der Wissenschaft voraus. Das tiefere Verständnis ergibt sich aus der Überwindung der konventionellen Schranken für die Wissenschaft, die im siebzehnten Jahrhundert in Europa errichtet und seitdem von der offiziellen Wissenschaft hartnäckig aufrechterhalten wurden.
Diese haben den Wissenschaftler in der Vergangenheit daran gehindert, die philosophische oder soziale Grundlage seiner Arbeit zu betrachten. Der Wert der Marx’schen Theorie für die Wissenschaft besteht darin, dass sie es uns ermöglicht, über die Ergebnisse bestehender Theorien hinaus zu schauen, um die Kräfte zu erkennen, die diese Theorien geprägt haben. Nur unter dieser Voraussetzung ist es möglich, die Theorien im Lichte der Entwicklung der Wissenschaft und der Produktivkräfte sowie des allgemeinen theoretischen Verständnisses, das der Marxismus selbst bietet, zu überdenken.
Natürlich ist der Prozess weder einfach noch leicht. Er ist mit sehr großen Kämpfen und Widersprüchen verbunden, denn die gesamte Ideologie der Wissenschaft selbst, eine Ideologie, die in jeder wissenschaftlichen Theorie enthalten ist, leitet sich von der des Kapitalismus ab.
In der Tat zeigt jedes ernsthafte Studium der Geschichte der Wissenschaft, dass sie von dem Moment an, als sie sich zu Beginn der Zivilisation vom praktischen Handwerk trennte, den Charakter und die Denkweise der oberen Klassen der gespaltenen Gesellschaft annahm. Eine solche Denkweise befasste sich kaum mit der materiellen Beherrschung der Umwelt, sondern vielmehr mit der Rechtfertigung der Abgeschiedenheit des überlegenen, der Kontemplation gewidmeten Wissenschaftlers, der durch seine Existenz die Ewigkeit der Klassengesellschaft behauptet.
Die Auseinandersetzungen und Kämpfe, die jetzt in der Sowjetunion auf vielen Gebieten der Wissenschaft – nicht nur auf dem berühmten Gebiet der Genetik – geführt werden, sind Ausdruck der großen intellektuellen Anstrengung, die unternommen wird, um mit der Vergangenheit zu brechen und die Wissenschaft auf ein Niveau sozialer und intellektueller Kohärenz zu heben, das sie nie zuvor hatte. Schon 1844 sah Marx die Notwendigkeit dafür (siehe Seite 23). Diejenigen, die heute von der Zerstörung der sowjetischen Wissenschaft unter dem Einfluss des Marxismus sprechen und in den meisten Fällen darauf hoffen, werden die gleiche Enttäuschung erleben wie Bertrand Russell, als er verkündete, dass eine auf marxistischen Prinzipien aufgebaute Atombombe niemals explodieren würde – nur eine Woche vor Trumans Ankündigung, explodierte sie.
Das andere Merkmal der Wissenschaft in der Sowjetunion und den neuen Demokratien ist ihr kooperativer und volksnaher Charakter. Marx‘ Kapital enthält einen erhellenden Abschnitt (Band I, Kap. XV, 5) „über den Kampf zwischen Arbeiter und Maschine“ in der Frühzeit des Kapitalismus. In der Tat empfinden die Arbeiter in den kapitalistischen Ländern immer noch zu Recht, dass die Anwendung der Wissenschaft in der Produktion letztlich auf ihre Kosten geht, dass sie in erster Linie Beschleunigung und in zweiter Linie Arbeitslosigkeit bedeutet. Nur in einem Staat, in dem die Arbeiter selbst das Sagen haben und in dem Arbeitslosigkeit unmöglich ist, wird diese natürliche und durchaus rationale Angst vor der Wissenschaft beseitigt. Gleichzeitig wird die Wissenschaft im Sozialismus zu einem Volksgut, wie es in kapitalistischen Ländern niemals möglich wäre, wo das Studium und die Ausübung der Wissenschaft mehr oder weniger ein ausschließliches Privileg der Mittel- und Oberschichten und der seltenen Exemplare der Arbeiterklasse sind, die sich leicht in sie einfügen lassen. In der Sowjetunion und den Neuen Demokratien ist dieses Monopol ebenfalls vollständig aufgebrochen. Die Wissenschaft wird zum Eigentum des ganzen Volkes. Zum einen dadurch, dass die meisten Wissenschaftler aus der arbeitenden Bevölkerung stammen, zum anderen dadurch, dass die arbeitende Bevölkerung direkt in die wissenschaftliche Forschung einbezogen wird, die für ihre beiden Probleme relevant ist.[15] So weckt sie ein Interesse, das nur dem in den kapitalistischen Ländern bestehenden Interesse an Sport oder Verbrechen entspricht.
Anhand dieser Erfahrung können wir sehen, wie die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Entwicklung im Kapitalismus verkrüppelt werden, weil die gesamte wissenschaftliche Tätigkeit in den Händen einer kleinen, quasi vererbten Klasse bleibt. Dies bremst unweigerlich jede wissenschaftliche Entwicklung, ganz abgesehen von den Beschränkungen, die sich aus der Klassenperspektive ergeben. Denn die Schnelligkeit des Fortschritts einer Unternehmung ist nicht nur proportional zur Zahl der damit beschäftigten Menschen, sondern hängt viel mehr von den Möglichkeiten ab, Menschen mit einem bestimmten Talent zu finden, und von der Anregung eines Menschen durch einen anderen. Diese Möglichkeiten und diese Anregung werden durch das kapitalistische Monopol der Wissenschaft behindert. Aber sie sind das unmittelbare Ergebnis der populären Ausbreitung der Wissenschaft im Sozialismus.
Die konstruktive Nutzung der Wissenschaft in den sozialistischen Ländern und der Versuch, den Kommunismus auf der Grundlage eines erfolgreichen Sozialismus in dem von Marx vorhergesagten Sinne aufzubauen, sind bereits der Beginn der nächsten Runde der dialektischen Transformation. Aber dieser Wandel unterscheidet sich radikal von dem, durch den der Kapitalismus in den Sozialismus umgewandelt wurde und immer noch umgewandelt wird. Das war eine gewaltsame Veränderung, die durch die Klassenspaltung der alten Gesellschaft notwendig wurde. Mit der Abschaffung der Klassen wird der Kampf nicht mehr von Mensch zu Mensch geführt, sondern findet auf dem Gebiet der Ideen und der Mittel zur Lösung materieller Probleme statt. Seine Methoden sind die der Kritik und der Selbstkritik. Mit den Worten Zhdanovs:
„In unserer Sowjetgesellschaft, in der die antagonistischen Klassen beseitigt sind, verläuft der Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen und folglich die Entwicklung vom Niederen zum Höheren nicht in Form von Kämpfen zwischen antagonistischen Klassen und von Katastrophen, wie es im Kapitalismus der Fall ist, sondern in Form von Kritik und Selbstkritik, die die wahre Triebkraft unserer Entwicklung ist, ein mächtiges Instrument in den Händen der Kommunistischen Partei. Dies ist unbestreitbar ein neuer Aspekt der Bewegung, eine neue Art der Entwicklung, ein neues dialektisches Gesetz.“[xxxvi]
Wir erleben heute in der Sowjetunion, wie auch in den neuen Demokratien und in China, nicht nur große materielle Errungenschaften, sondern auch eine aufregende neue Phase in der geistigen Entwicklung der Menschheit, in der die Ideen von Marx zu neuen materiellen und geistigen Errungenschaften anregen und in der das Verständnis der Welt, von dem er träumte, Gestalt annimmt. Denn der Philosoph hat in der Tat begonnen, die Welt zu verändern, und was wir jetzt gesehen haben, ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Der Kampf liegt noch vor uns, aber wir können zuversichtlich in die Zukunft blicken, denn der Mensch wird durch das Wissen endlich Herr seines Schicksals. Dann beginnt, wie Marx gezeigt hat, seine eigentliche Geschichte.
Ich kann am treffendsten mit den Worten von Engels am Grab von Marx schließen, wo er den Beitrag von Marx zur Vertiefung und Erweiterung der Wissenschaft hervorhob:
„Wie Darwin das Gesetz der Evolution in der organischen Natur entdeckte, so entdeckte Marx das Gesetz der Evolution in der menschlichen Geschichte. Er entdeckte die einfache, bisher durch ein Übermaß an Ideologie verdeckte Tatsache, dass die Menschheit zuerst essen und trinken, Unterkunft und Kleidung haben muss, bevor sie Politik, Wissenschaft, Religion, Kunst usw. betreiben kann, und dass daher die Produktion der unmittelbaren materiellen Existenzmittel und folglich der Grad der wirtschaftlichen Entwicklung, den ein bestimmtes Volk oder eine bestimmte Epoche erreicht hat, die Grundlage bildet, auf der sich die staatlichen Institutionen, die Rechtsauffassungen, die Kunst und sogar die religiösen Vorstellungen des betreffenden Volkes entwickelt haben. In deren Licht müssen diese Dinge daher erklärt werden, und nicht umgekehrt, wie es bisher der Fall war.
„Aber das ist noch nicht alles. Marx entdeckte auch das besondere Bewegungsgesetz der heutigen kapitalistischen Produktionsweise und der bürgerlichen Gesellschaft, die diese Produktionsweise geschaffen hat. Die Entdeckung des Mehrwerts warf plötzlich Licht auf das Problem, bei dessen Lösung alle früheren Forscher, sowohl bürgerliche Ökonomen als auch sozialistische Kritiker, im Dunkeln getappt waren.
„Zwei solche Entdeckungen sollten für ein Leben genügen. Glücklich schon der, dem es vergönnt ist, nur eine solche zu machen. Aber auf jedem einzelnen Gebiet, das Marx der Untersuchung unterwarf, und dieser Gebiete waren sehr viele und keines hat er bloß flüchtig berührt – auf jedem, selbst auf dem der Mathematik, hat er selbständige Entdeckungen gemacht.
So war der Mann der Wissenschaft. Aber das war noch lange nicht der halbe Mann. Die Wissenschaft war für Marx eine geschichtlich bewegende, eine revolutionäre Kraft. So reine Freude er haben konnte an einer neuen Entdeckung in irgendeiner theoretischen Wissenschaft, deren praktische Anwendung vielleicht noch gar nicht abzusehen – eine ganz andere Freude empfand er, wenn es sich um eine Entdeckung handelte, die sofort revolutionär eingriff in die Industrie, in die geschichtliche Entwicklung überhaupt.[xxxvii]
[1] Das Wort „entfremdet“ wird von Marx in einem metaphorischen Sinn verwendet. Materielle Güter sind das Produkt menschlicher Arbeit: Sie nehmen einen Teil des Lebens der Arbeiter ein, die sie produzieren. Durch die Verkörperung dieses Anteils wird er sozusagen aus dem Leben genommen und beiseite gestellt (entfremdet), so wie der Mensch sein eigenes Eigentum durch den Verkauf entfremdet.
[2] In seiner Geschichte der Philosophie schreibt Hegel: „Die Veränderungen in der Natur, so unendlich mannigfach sie sind, zeigen nur einen Kreislauf, der sich immer wiederholt; in der Natur geschieht nichts Neues unter der Sonne[…] Nur in den Veränderungen, die auf dem geistigen Boden vorgehen, kommt Neues hervor. Diese Erscheinung am Geistigen ließ in dem Menschen eine andre Bestimmung überhaupt sehen als in den bloß natürlichen Dingen – in welchen sich immer ein und derselbe stabile Charakter kundgibt, in den alle Veränderung zurückgeht, – nämlich eine wirkliche Veränderungsfähigkeit und zwar zum Besseren – ein Trieb der Perfektibilität.“
[3] Die Zahlen des Pythagoras wurden von ihm als tatsächliche kleine Körper aufgefasst, die aus Stapeln von Punkten bestehen, so dass seine Philosophie als materialistisch bezeichnet werden könnte. Doch seine Anhänger, insbesondere Platon, nahmen die Zahl in ihrem abstrakten und sogar magischen Sinn und machten sie zum Eckpfeiler eines durch und durch idealistischen Denkens.
[4] Die 900 Seiten seiner mathematischen Manuskripte sind jetzt veröffentlicht worden, allerdings bisher nur auf Russisch. Einige von ihnen werden hier besprochen: Dirk J. Struik: Marx and Mathematics. Science and Society, Vol. 12, Band 1, 1948, S. 181-196.
[5] Siehe Fußnote S. 6
[6] In Kapital, Band. I, Kapitel XV.
[7] Siehe Babbage, C: On the Economy of Machinery and Manufactures. London, 1832.
[8] Hier ist eine sehr höflich formulierte offizielle Einschätzung dessen, was auf uns zukommt:
„… Eine unserer Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme der Universitäten besteht darin, dass Universitätsprofessoren und Wissenschaftler weitgehend den Anspruch erheben, alles, was sie entdecken, veröffentlichen zu dürfen. Ein großer Teil der Arbeit, die wir von ihnen verlangen, ist so geheim, daß wir ihnen nicht erlauben könnten, sie zu veröffentlichen, und das behindert in gewissem Maße unseren Stil. Das ist ein Punkt, den ich zur Zeit mit Sir John Lennard-Jones, dem Vorsitzenden unseres wissenschaftlichen Beirats, diskutiere, und ich habe ihn gefragt, ob er die Universitäten dazu bringen könnte, etwas mehr „gezielte“ Forschung zu betreiben.
Er hofft, etwas in dieser Richtung tun zu können. Es ist ein wirklicher Punkt, dass die Universitäten mehr für uns tun könnten, aber sie sind nicht bereit, die Beschränkungen zu akzeptieren, die wir in Bezug auf bestimmte Projekte auferlegen können.“ (Aussage von Sir Archibald Rowlandson [Permanent Secretary Ministry of Supply] vor dem Select Committee on Estimates 17. Bericht [Sub-Cttee. B.] „The Defense Estimates“, HMSO, S.7, Abs. 1311.)
Eine weitere, noch eindringlichere Erinnerung gab Viscount Portal in einer Rede anlässlich des Royal Society Anniversary Dinner im November 1951:
„… Es kann sehr wenige Menschen mit einem Funken Idealismus in sich geben, die das Ideal der Freiheit der Wissenschaft nicht respektieren und bewundern. Aber ich kann mit gleicher Aufrichtigkeit sagen, dass es nur sehr wenige Menschen mit einem Funken politischen Verstandes in sich geben kann, die nicht sehen, dass dieses Ideal, zumindest für die Gegenwart, nicht die volle Herrschaft erlangen kann. . . .
„Es gibt bereits eine große Anzahl von Wissenschaftlern und Technologen, die für die Industrie arbeiten und denen die Idee der Geheimhaltung vertraut ist. Diese Männer haben nicht empfunden, dass die Loyalität gegenüber dem wissenschaftlichen Ideal unvereinbar ist mit der Loyalität gegenüber dem Unternehmen, das sie anstellt. Wie viel weniger sollte es unvereinabr mit Ihrer Loyalität zu ihrem eigenen Land sein?
„Wir müssen jedoch anerkennen, dass es einige Wissenschaftler gibt, die aus Gewissensgründen die Notwendigkeit von Beschränkungen ablehnen und die durch die Verbreitung ihrer eher einseitigen Ansichten dazu beitragen können, die nationale Loyalität einiger, insbesondere junger Menschen, auf die wir angewiesen sind, zu schwächen.“
[9] Dr. Du Bois, einer der renommiertesten amerikanischen Soziologen, musste sich im Alter von 82 Jahren vor Gericht verantworten als nicht registrierter ausländischer Agent, weil er sich für den Frieden ausgesprochen hatte.
Dass er freigesprochen wurde, ist ein Tribut an den weltweiten Protest, den sein Fall auslöste.
Professor Struik vom Massachusetts Institute of Technology wurde angeklagt für Verschwörung zum gewalttätigen Sturz der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, weil er marxistische Theorien lehrte.
Dr. Spitzer wurde von seinem Posten entlassen, weil er in einer wissenschaftlichen Zeitschrift schrieb, dass es ratsam wäre, die Theorien von Lysenko zu studieren, bevor man sie anprangert. Noch näher liegt der Fall von Joliot-Curie, der seinen Posten als Direktor der Atomenergie in Frankreich verlor, weil er erklärte, dass er sich nicht an der Nutzung der Atomenergie für zerstörerische Zwecke beteiligen würde.
[10] Siehe Stewart, G.R: The Year of the Oath. The fight for academic freedom at the University of California. New York, 1950.
[11] Siehe Gellhorn, W: Security, Loyalty and Science. Cornell, 1950, in dem die negativen Auswirkungen der Gedankenkontrolle in der Wissenschaft bereits deutlich werden.
[12] Sir Walter Moberly zeigt, wie dies auf die sanfteste und unaufdringlichste Art und Weise geschehen kann:
„Für den Umgang mit ehrlichen Häretikern lässt sich keine doktrinäre Regel aufstellen, aber es gibt zwei Leitprinzipien. Erstens muss die Grundausrichtung der Universität gewahrt werden. Die Zulassung von Personen zu Lehraufträgen, die sie in einem Maße verleugnen, das sie gefährdet, ist abzulehnen. Zweitens können Häretiker, wie wir gesehen haben, einen echten Beitrag leisten und sollten unter den oben genannten Voraussetzungen nicht nur toleriert, sondern willkommen geheißen werden.
„Die praktische Anwendung dieser Grundsätze wird bei verschiedenen Ämtern und verschiedenen Fächern unterschiedlich sein. Handelt es sich um die Ernennung zum Vizekanzler oder Rektor, zum „Leiter eines Hauses“, zum Vorsteher eines Saals oder, was noch zweifelhafter ist, zum Dekan einer Fakultät, so ist daran zu denken, dass er in seiner eigenen Institution der einzige seiner Art ist. Als ihr offizielles Oberhaupt sollte er die einflussreichste Person in ihr sein. Er kann einer der verschiedensten Denkrichtungen angehören, aber seine grundlegenden Werte und Ansichten sollten mit denen der Universität übereinstimmen.“ (The Crisis in the University, London, 1949, S. 159.)
[13] Dies findet seinen praktischen Ausdruck in den relativen Summen von weit unter 1.000.000.000 Dollar, die von der US-Regierung für die Unterstützung der unterentwickelten Länder, in denen 1.100.000.000 Menschen leben, veranschlagt wurden (im Rahmen von Präsident Trumans berühmtem „Point four“-Programm), und über 50.000.000.000 Dollar, die für militärische Vorbereitungen veranschlagt wurden (1952-53).
[14] Siehe Bernal, J.D: The Developments of Soviet Science. in: Anglo-Soviet Journal, Vol. 12, Nr. 3, 1951; Bernal, J.D: Grand Construction Works of the Stalin Epoch. in: New Timer, Nr. 39, 1950; und Bernal, J.D: Man Conquers Nature. London, 1952.
[15] Siehe Fish, A: The People‘s Academy. Moskau, 1949.
[i] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Ergänzungsband, Teil 1, S. 537.
[ii] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 3, S. 45 f.
[iii] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 21, S. 266.
[iv] Ebenda, S. 267 f.
[v] Ebenda, S. 270 f.
[vi] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 40, S. 305.
[vii] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 1, S. 379.
[viii] Ebenda, S. 378.
[ix] Eigene Übersetzung nach J.D. Bernal: Marx and Sience. New York 1952.
[x] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 23, S. 27.
[xi] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 4, S. 143.
[xii] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 30, S. 131.
[xiii] Ebenda, S. 578.
[xiv] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 3, S. 28.
[xv] Ebenda, S. 5.
[xvi] Ebenda, S. 6.
[xvii] Ebenda.
[xviii] Ebenda, S. 7.
[xix] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Ergänzungsband, Teil 1, S. 543.
[xx] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 19, S. 21.
[xxi] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 3, S. 43 f.
[xxii] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 39, S. 205.
[xxiii] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 3, S. 46.
[xxiv] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 20, S. 10.
[xxv] Siehe [ix].
[xxvi] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 23, S. 393.
[xxvii] Ebenda, S. 395.
[xxviii] Ebenda, S. 380.
[xxix] Ebenda, S. 380.
[xxx] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 25, S. 113.
[xxxi] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 23, S. 382.
[xxxii] Siehe [ix].
[xxxiii] Siehe [ix].
[xxxiv] Siehe [ix].
[xxxv] Siehe [ix].
[xxxvi] Siehe [ix].
[xxxvii] Karl Marx und Friedrich Engels: Werke, Band 19, S. 336.